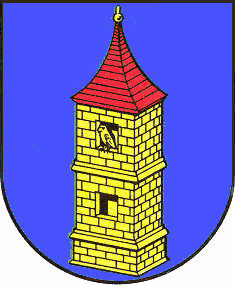| Bild |
Bezeichnung |
Lage |
Datierung |
Beschreibung |
ID
|
 |
Wohnhaus in geschlossener Bebauung |
Annenstraße 15
(Karte) |
2. Hälfte 19. Jahrhundert |
Original erhaltener Putzbau mit großer Toreinfahrt, bau- und ortsentwicklungsgeschichtlich von Bedeutung. Zweigeschossiger Massivbau mit mittigem Zwerchgiebel, Fenster- und Türgewände Hilbersdorfer Porphyrtuff, Haustor original erhalten (2014). |
09248037
|
 |
Wohnhaus in geschlossener Bebauung |
Annenstraße 23
(Karte) |
2. Hälfte 19. Jahrhundert |
Putzbau mit nachträglich eingebauten Läden, ortsentwicklungsgeschichtlich von Bedeutung. Zweigeschossiger Massivbau mit mittigem Zwerchgiebel, Fenster- und Türgewände Hilbersdorfer Porphyrtuff, Ladeneinbauten nachträglich und später vermutlich nochmals überformt (Minderung des Denkmalwertes). |
09248038
|
 |
Wohnhaus in geschlossener Bebauung (zeitweise Kur- und Wannenbäder Fr. Haberkorn) |
Annenstraße 26
(Karte) |
Bezeichnet mit 1810 »FAB« laut Schlussstein |
Putzbau aus dem beginnenden 19. Jahrhundert in gutem Originalzustand, bau- und ortsentwicklungsgeschichtlich von Bedeutung. Zweigeschossiger Massivbau, leicht überformt um 1925 Holländerwindmühle – u. a. Inschrift sowie Dekoration Fenstergewände sowie Erhöhung der einen Eingangstür, Sockel Rochlitzer Porphyrtuff, stehende Gaupen. |
09247988
|
 |
Hauskeller (Heiliger Florian) |
August-Bebel-Straße 15
(Karte) |
Um 1780 |
Ortsgeschichtlich von Bedeutung. Mehrschiffiger Hauskeller mit Tonnengewölben und Stützen aus Naturstein. |
08992501
|
 |
Wohnhaus mit Anbau und Heiste |
Döbelner Straße 2
(Karte) |
Um 1850 (Wohnhaus); um 1900 (Seitenflügel Döbelner Straße) |
Zeittypischer Putzbau aus der Mitte des 19. Jahrhunderts in gutem Originalzustand von ortsentwicklungsgeschichtlicher, baugeschichtlicher und städtebaulicher Bedeutung. Zweigeschossiger Massivbau, verputzt, Türportal mit Rundbogen und Schlussstein, Fensterbankgesims an.der Traufseite, im Obergeschoss Fenster mit Segmentbögen überdacht, an Traufseite zu Fensterband zusammengefasst, Abschluss durch Krüppelwalmdach mit zweiachsigem Dacherker mit Satteldach, beiderseits zwei zweiachsige Gauben, die Fassade des Hauses vermutlich in den 1920er Jahren überformt, dem Haupthaus vorgelagert Heiste mit Bruchsteintreppenwange, an dieses Haus schließt in der Döbelner Straße der ebenfalls zweigeschossige Seitenflügel mit Satteldach an, dessen Gestaltung sehr schlicht ist. Der Denkmalwert des Hauses ergibt sich aus dem baugeschichtlichen Wert auf Grund der anspruchsvollen und zeittypisch erhaltenen Hausgestaltung sowie der städtebaulichen Bedeutung als Teil des Marktplatzensembles und der in Kirchennähe befindlichen Bebauung. |
09305511
|

Weitere Bilder |
Stadtpark Reinhardtsthal (Sachgesamtheit) |
Dresdener Straße
(Karte) |
1926–1933 (Entwurf und Ausführung) |
Sachgesamtheit Stadtpark Reinhardtsthal mit dem Einzeldenkmal: OdF-Denkmal (09305385) und folgenden Sachgesamtheitsteilen: östlicher Einfriedungsmauer mit zwei Kugelsteinen und Erinnerungstafel, Wegesystem, struktur- und raumbildender Bepflanzung, Teich mit Böschung, Mauerabschluss und Kugelsteinbrunnen und Ausstattungselementen wie zehn Kugelsteinen, vier Sockeln der ehemals vorhandenen Kinderfiguren und Pflanzkübel; weitgehend ursprünglich erhalten mit später eingefügtem Gedenkstein, gartenkünstlerisch und ortsgeschichtlich von Bedeutung[Ausführlich 1] |
09247973
|

Weitere Bilder |
OdF-Denkmal (Einzeldenkmal der Sachgesamtheit 09247973) |
Dresdener Straße
(Karte) |
Nach 1945 |
Einzeldenkmal der Sachgesamtheit Stadtpark Reinhardtsthal; Gedenkstein mit Inschrift aus Granit, ortsgeschichtlich von Bedeutung. Nach 1948 Umgestaltung des Mittelteils des ehemaligen Stadtparkes sowie Errichtung eines VdN-Gedenksteines (und zeitweise Umbenennung des Stadtparks in Thälmann-Breitscheid-Park). |
09305385
|

Weitere Bilder |
Halbmeilensäule |
Dresdener Straße (Ecke Goethestraße)
(Karte) |
Vor 2022 (Kopie), Original bezeichnet mit 1722 |
Kursächsische Postmeilensäule (Sachgesamtheit); Nachbildung der Halbmeilensäule, von verkehrsgeschichtlicher Bedeutung. Kopie einer kursächsischen Halbmeilensäule aus Rochlitzer Porphyr von 1722 mit der Reihennummer 26 und verschiedenen Inschriften. Spiegel 1: „AR“ „Waldheim 1 St“, Posthornzeichen, „1722“, Posthornzeichen, 2. Spiegel: „Geringswalda 1 St. 1/8 Rochlitz 3 St. 1/4“, „1722“, Posthornzeichen. Das am Harthaer Kreuz gefundene Originalteil befindet sich im städtischen Bauhof / örtlichen Industriemuseum (2014). |
09248034
|
 |
Wohnhaus in geschlossener Bebauung |
Dresdener Straße 16
(Karte) |
Um 1800 |
Stattliches Bürgerhaus in gutem Originalzustand, baugeschichtliche Bedeutung. Zweigeschossiger Massivbau, Fenster- und Türgewände Rochlitzer Porphyr, stehende Gaupen, Fenster erneuert. |
09248035
|
 |
Mietshaus in geschlossener Bebauung (Seitenflügel des Wohnhauses Dresdener Straße 39) |
Dresdener Straße 39
(Karte) |
Um 1905 |
Zeittypisches Gebäude in Klinkermischbauweise in gutem Originalzustand, baugeschichtlich, städtebaulich und stadtentwicklungsgeschichtlich von Bedeutung. Zweigeschossiges Gebäude in Klinkermischbauweise, um 1905 erbaut. Das Haus blieb weitgehend original erhalten und beeindruckt durch seine besonders zeittypische Ausprägung, so z. B. der Natursteinsockel, die Putznutung im Erdgeschoss, die Klinkerverblendung mit andersfarbigen Klinkerbändern im Obergeschoss und Dacherker sowie die charakteristischen Fenstergewände mit waagerechter Verdachung bzw. Dreieckgiebelchen sowie floralen Dekorationen. Das Haus ist Teil eines annähernd zeitgleich erbauten Straßenzuges in nahezu identischer Gestaltung. Der Denkmalwert dieses Hauses ergibt sich somit aus der baugeschichtlichen, städtebaulichen sowie stadtentwicklungsgeschichtlichen Bedeutung. |
09305489
|
 |
Mietshaus in halboffener Bebauung |
Dresdener Straße 71
(Karte) |
Um 1900, später überformt |
Putzbau mit qualitätvoller Fassadendekoration (Überformung der Zeit um 1910), bau- und stadtentwicklungsgeschichtlich von Bedeutung. Zweigeschossiger Putzbau, um 1905 erbaut. Mittelrisalit mit Drillingsfenstern und flach abschließendem Dacherker, flankiert von stehenden Gauben. Das Gebäude zeichnet sich durch seine qualitätvolle neobarocke Putzstuckdekoration u. a. mit Füllhörnern und Lisenen aus. Dabei handelt es sich möglicherweise um eine Überformung. Ähnlich gestaltete Häuser finden sich noch in Hartha. Es handelt sich dabei um eine in dieser Art selten anzutreffenden Gestaltung, die möglicherweise auf einen Baumeister zurückzuführen ist. Auf Grund dieser besonderen Gestaltung kommt dem Bauwerk eine baugeschichtliche Bedeutung zu. |
09305479
|

Weitere Bilder |
Mietshaus in halboffener Bebauung und in Ecklage |
Dresdener Straße 77, 77a
(Karte) |
Um 1905 |
Repräsentatives Eckhaus mit Laden, durch Jugendstil inspirierte Fassadendekorationen, baugeschichtlich und städtebaulich von Bedeutung. Dreigeschossiger Massivbau mit Jugendstilornamentik, Haupteingangstür und Okulus original, Fenster, Türen sonst erneuert, Balkonanbau neu. |
09247977
|
 |
Fabrikgebäude sowie Reste der Einfriedung (Webwaren-Fabrik Richard Möbius) |
Dresdener Straße 84
(Karte) |
Um 1900 |
Letztes erhaltenes Fabrikgebäude eines ursprünglich umfangreichen Industriekomplexes, von herausragender Bedeutung für die Harthaer Industriegeschichte. Fabrikbautenkomplex mit Massivbauten, klinkerverkleidet mit Greppiner Verblendklinkern und alternierend grün glasierten Kacheln, Segmentbogenfenstern, Zahnschnittgesimsen, Natursteinsockeln. Tragkonstruktion: Stahlskelett bzw. Stahlbeton, Flachdach bzw. Sheddachkonstruktionen, bauzeitliche Türen und Fenster weitgehend erhalten.
Teilabbruch Industrieanlage (Websaal mit Sheddach) 2007. |
09247968
|
 |
Ehemalige Fabrikantenvilla mit Ausstattung, heute Kindergarten |
Dresdener Straße 84a
(Karte) |
1910/1911 |
Villa des Textilfabrikanten Richard Möbius, repräsentatives Beispiel der Reformarchitektur in Hartha, baukünstlerisch sowie orts- und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung. Zweigeschossiger Massivbau auf Natursteinsockel mit großem Walmdach, prägnante Balkone mit hölzernen Balustraden und Stützen, farbig gefasstes Traufgesims mit Ornamentmalerei, weitestgehend erhaltene Innenausstattung (wandfest), Bauherr war Textilfabrikant Richard Möbius. |
09247966
|
 |
Wohnhaus in halboffener Bebauung (ehemals Brikett-Kohlen und Holzhandlung von Arno Hoffsky) |
Feldstraße 14
(Karte) |
2. Hälfte 19. Jahrhundert |
Schlichtes Wohnhaus und Geschäftshaus des Kohlen- und Holzhändlers Arno Hoffsky von regionalgeschichtlichem Wert. Zweigeschossiger Massivbau (Feldsteine) mit Satteldach, schiefergedeckt und stehende Gaupen, im ersten Obergeschoss Konsolen, südliche Hausecke geputzte Pilaster mit figürlichem Schlussstein und Rosette, Fenster erneuert, geringer Denkmalwert. |
09247994
|

Weitere Bilder |
Sparkassengebäude (ehemals Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt) |
Flemmingener Straße 1
(Karte) |
Zwischen 1856 und 1880 |
Repräsentatives Geschäftsgebäude der ehemaligen Allgemeinen Deutschen Credit-Anstalt, zusammengebaut mit älterem Gebäudeteil, regionalgeschichtlich, ortsentwicklungsgeschichtlich sowie baukünstlerisch von Bedeutung. Zweigeschossiger verputzter Massivbau mit Mittelrisalit und Giebel (ornamental gefasstem Typus-Relief u. a. mit Kopfdarstellung), Fenster und Türen mit Natursteingewänden in strengen, spätklassizistischen Architekturformen, im Erdgeschoss Rundbogenfenster, im Obergeschoss Rechteckfenster mit waagerechter Verdachung, möglicherweise zu späterem Zeitpunkt giebelständig erweitert (in gleicher Gestaltung wie Ursprungsbau – nicht durch Bauakten belegt), teils mit neuzeitlichen Anbauten ohne Denkmalwert sowie älterem Hausteil unbekannter Funktion (eventuell ländliches Gebäude, welches zum ehemaligen Dorf Flemmingen gehörte). |
09248116
|
 |
Parkanlage (Stadtpark, ehemals Wettin-Platz) |
Franz-Mehring-Straße
(Karte) |
1928–1948 (Ausführung des Wettin-Platzes) |
Ehemals als Schmuckplatz angelegt und zur Parkanlage umgestaltet, mit Geländemodellierung und Flächengliederung, Wegeanlagen, struktur- und raumbildender Bepflanzung sowie die den Park rahmenden Fußwege inklusive Baumreihen, weitgehend ursprünglich erhalten, ortsgeschichtlich, gartenkünstlerisch und städtebaulich von Bedeutung.
1888 wurde das Gelände des heutigen Stadtparks durch die Stadt Hartha erworben. Aus dem Jahr 1909 sind Entwürfe für einen Schmuckplatz von Otto Moßdorf (Garten-Ing., Leipzig) überliefert, die aber nicht ausgeführt wurden. Es folgte 1913 ein Entwurf für einen Schmuckplatz von Rudolf Kolbe (Architekt B.d.A., Dresden-Loschwitz). Diese Pläne für den „Wettin-Platz“ wurden im Zeitraum 1928 bis 1948 umgesetzt. Es folgte 1938 bis 1940 nach Plänen von Poeth, Hermann und Kleinmann (Dipl.-Ing. Hartha) eine Umgestaltung. 1992 erfolgten über ABM-Maßnahmen Instandsetzungsmaßnahmen. Der Park erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit bei Harthas Bürgern, woraus sich u. a. seine stadtgeschichtliche Bedeutung ableitet. Als charakteristischer Schmuckplatz des beginnenden 20. Jahrhunderts erlangt dieser durch verschiedene Zeitschichten geprägte Park auch gartenkünstlerische Bedeutung.[Ausführlich 2] |
09247974
|
 |
Verwaltungsgebäude mit Einfriedung (Allgemeine Ortskrankenkasse) |
Franz-Mehring-Straße 25
(Karte) |
1927–1928 |
Repräsentatives Verwaltungsgebäude in neobarocken Architekturformen, bau- und ortsgeschichtlich von besonderer Bedeutung. Dreigeschossiger Massivbau mit Mansarddach, ornamentale Bleiverglasung im Treppenhaus, Fenster erneuert, bauzeitliche Einfriedung, monumentales Haupt- und Traufgesims, offene Balkone zur Nordwestseite. |
09247993
|

Weitere Bilder |
Mietshaus in offener Bebauung in Ecklage (ehemals Hotel und Garten-Restaurant Feldschlößchen) |
Gallbergstraße 1
(Karte) |
1898 |
Ehemaliges Hotel und Garten-Restaurant, ursprünglich mit Kegelbahn in städtebaulich dominanter Lage, bau-, orts- und stadtentwicklungsgeschichtlich von Bedeutung. 1898 vermutlich als Hotel und Garten-Restaurant erbautes Haus in städtebaulich dominanter Lage. Zweigeschossiger Putzbau mit polygonalem Eckrisalit und zeittypischer Fassadenausbildung. Mit Ausnahme der nicht mehr erhaltenen Kegelbahn blieb das heute als Mietshaus genutzte Gebäude weitgehend original erhalten. Durch seine Größe und dominante Lage prägt dieses maßgeblich die Leipziger Straße als Dominante an der Ortseinfahrt. Durch die langjährige Nutzung als Hotel und Garten-Restaurant dürfte das Haus zumindest bei der älteren Bevölkerung Harthas mit vielen Erinnerungen verbunden sein, woraus sich dessen ortsgeschichtlicher Wert ableitet. Als authentisch erhaltenes Bauwerk des ausgehenden 19. Jahrhunderts in besonders typischer Ausprägung erlangt das ehemalige Hotel mit Garten-Restaurant auch baugeschichtliche Bedeutung. Mittelrisalit mit Drillingsfenstern und flach abschließendem Dacherker, flankiert von stehenden Gauben. Das Gebäude zeichnet sich durch seine qualitätvolle neobarocke Putzstuckdekoration u. a. mit Füllhörnern und Lisenen aus. Dabei handelt es sich möglicherweise um eine Überformung. Ähnlich gestaltete Häuser finden sich noch in Hartha. Es handelt sich dabei um eine in dieser Art selten anzutreffenden Gestaltung, die möglicherweise auf einen Baumeister zurückzuführen ist. |
09305485
|

Weitere Bilder |
Villa |
Gallbergstraße 3
(Karte) |
Um 1910 |
Reich dekorierter Putzbau von baukünstlerischer Bedeutung. Zweigeschossiger Massivbau, verputzt mit erkerartigem Risalit (Altan), Krüppelmansarddach, Anbau mit Garage, dekorativer Putz mit Festons, Fassade mit Fenstern erneuert. |
09247981
|
 |
Mietshaus in geschlossener Bebauung in Ecklage |
Gerhart-Hauptmann-Straße 2
(Karte) |
Um 1900 |
Repräsentatives Gebäude in Klinkermischbauweise mit Eckladen, bau- und ortsentwicklungsgeschichtlich von Bedeutung. Zweigeschossiger Massivbau mit dreigeschossigem Eckrisalit, klinkerverkleidet, stehende Gaupen, Satteldach, Sockelgeschoss verputzt, Fenster erneuert. |
09248017
|
 |
Mietshaus in geschlossener Bebauung |
Gerhart-Hauptmann-Straße 10
(Karte) |
Um 1900 |
Zeittypischer Klinkerbau in einem geschlossenen Straßenzug gleicher Entstehungszeit und annähernd gleicher Gestaltung, baugeschichtlich, städtebaulich und ortsentwicklungsgeschichtlich von Bedeutung. Zweigeschossiger Massivbau, Klinker verkleidet mit Zwerchgiebel und stehenden Gaupen, bauzeitliche Haustür, Fenster und eine Haustür erneuert. |
09248016
|
 |
Mietshaus in geschlossener Bebauung |
Gerhart-Hauptmann-Straße 14
(Karte) |
Um 1905 |
Zeittypischer Klinkerbau mit Dacherker in gutem Originalzustand, Teil eines zeitgleich entstandenen Straßenzuges, baugeschichtlich, städtebaulich und stadtentwicklungsgeschichtlich von Bedeutung. Zweigeschossiger Klinkerbau über sechs Fensterachsen. Die Fassade wird geprägt durch die zeittypischen Fenstergewände und Türportale. Die Schlusssteine der Fenstergewände zeigen eine Diamantquaderung. Belebt wird der rote Klinkerbau durch gelbe Klinkerbänder. Die Hausmitte wird durch zwei Fenster mit Segmentbogenverdachung und den Dacherker betont, welcher im Straßenzug mehrfach anzutreffen ist. Das Mietshaus ist Teil eines zeitgleich entstandenen Straßenzuges in ähnlicher Gestaltung. Hierdurch verdeutlicht der Straßenzug die Stadterweiterung Harthas um 1900, die im Zusammenhang mit der prosperierenden Industrie stand. Damit ergibt sich der Denkmalwert des Miethauses Gerhart-Hauptmann-Straße 14 aus dessen baugeschichtlicher und stadtentwicklungsgeschichtlicher Bedeutung. |
09305497
|
 |
Mietshaus in geschlossener Bebauung |
Gerhart-Hauptmann-Straße 16
(Karte) |
Um 1905 |
Zeittypischer Klinkerbau mit Dacherker in gutem Originalzustand, Teil eines zeitgleich entstandenen Straßenzuges, baugeschichtlich, städtebaulich und stadtentwicklungsgeschichtlich von Bedeutung. Zweigeschossiger gelber Klinkerbau mit original erhaltener Fassadengliederung, so u. a. kräftige Gurt- und Fensterbankgesimse, waagerechte Fensterverdachungen mit kleinen Reliefs (Engelköpfe u. a.). Das Gebäude ist Teil eines relativ einheitlich gestalteten Straßenzuges, welcher annähernd gleichzeitig entstand. Durch diese Einheitlichkeit dokumentiert der Straßenzug die Stadtentwicklung infolge der prosperierenden Industrie in Hartha um 1900 eindrucksvoll. Gleichzeitig ist das Gebäude ein gutes Beispiel des Bauhandwerks der Jahrhundertwende. Aus beiden Gegebenheiten ergibt sich die baugeschichtliche und stadtentwicklungsgeschichtliche Bedeutung des Mietshauses Gerhart-Hauptmann-Straße 16. |
09305496
|
 |
Mietshaus in Ecklage und in geschlossener Bebauung |
Gerhart-Hauptmann-Straße 22
(Karte) |
Um 1900 |
Zeittypischer Klinkerbau mit polygonaler Eckausbildung, ursprünglich mit Eckladen, in gutem Originalzustand, Teil eines zeitgleich entstandenen Straßenzuges, baugeschichtlich, städtebaulich und stadtentwicklungsgeschichtlich von Bedeutung. Zweigeschossiger, an der Ecke dreigeschossiger Klinkerbau mit zeittypischer reicher Historismusdekoration in gutem Originalzustand. Das Gebäude ist Teil eines zeitgleich entstandenen Straßenzuges, der sich durch eine einheitliche Gestaltung auszeichnet. Durch diese Einheitlichkeit verdeutlicht dieser Straßenzug die im Zusammenhang mit der prosperierenden Industrie erfolgte Stadterweiterung um 1900. Der Denkmalwert ergibt sich somit aus dem baugeschichtlichen und stadtentwicklungsgeschichtlichen Wert. |
09305495
|
 |
Mietshaus in geschlossener Bebauung und Ecklage |
Goethestraße 2
(Karte) |
Um 1900 |
Repräsentatives Eckhaus in Klinkermischbauweise mit Laden, baukünstlerische, stadtentwicklungsgeschichtliche und städtebauliche Bedeutung. Zweigeschossiger Massivbau, Sockelgeschoss rustizierend geputzt, darüber klinkerverkleidet, dreigeschossiger Eck- und zwei Seitenrisalite mit Neorenaissancegiebeln, Architekturteil in Neorenaissanceformen. |
09248014
|
 |
Mietshaus in geschlossener Bebauung |
Goethestraße 4
(Karte) |
Um 1905 |
Zeittypisches Mietshaus mit Läden im Erdgeschoss in Klinkermischbauweise mit seltener Stufengiebelgestaltung, baugeschichtlicher Wert. Dreigeschossiger Massivbau mit neogotischen Zwerchgiebeln, Klinker und Putzgewände aus Werkstein mit freien Jugendstilformen. |
09247992
|
 |
Ehemaliges Kino „Lichtspiel-Theater“ (ohne Saalanbau) und Mietshaus in geschlossener Bebauung |
Goethestraße 8
(Karte) |
1911 |
Schlichter Putzbau mit aufwendig gestaltetem Erdgeschoss, als vermutlich erstes Lichtspieltheater Harthas von stadtgeschichtlicher Bedeutung. Dreigeschossiger Massivbau, verputzt, mit Zwerchgiebel, Tor Haupteingang mit Arkaden mit floraler Jugendstilornamentik, Fassade und Fenster erneuert.
Nach Angaben der ortsgeschichtlichen Literatur 1911 erbaut als Lichtspieltheater und Wohnhaus, am 2. September 1911 erfolgte die Eröffnung des Lichtspieltheaters, Inhaber war Georg Ottomar Voigt, von 1924 bis 1934 bleibt Georg Voigt Inhaber des Kinos, ab 1937 bis 1941 wird Hedwig Voigt, ansässig in Leipzig als Inhaberin des Kinos genannt. Vermutlich bis um 1990 genutzt. |
09247991
|
 |
Wohnhaus (ehemaliges Stadtgut) in geschlossener Bebauung |
Goethestraße 17
(Karte) |
Um 1840 |
Markanter Putzbau aus dem beginnenden 19. Jahrhundert mit großer Toreinfahrt in der Annenstraße, orts- und baugeschichtlich von Bedeutung. Zweigeschossiger Massivbau, Fenster mit Natursteingewänden, Walmdach, schiefergedeckte und stehende Gaupen (um 1905), Fenster erneuert, eventuell Bürgerhaus mit Landwirtschaft. |
09247989
|

Weitere Bilder |
Sachgesamtheit Königlich-Sächsische Triangulierung („Europäische Gradmessung im Königreich Sachsen“); Station 100, Kreuz |
Hartha Kreuz
(Karte) |
Bezeichnet mit 1869 |
Triangulationssäule; Station 2. Ordnung, bedeutendes Zeugnis der Geodäsie des 19. Jahrhunderts, vermessungsgeschichtlich von Bedeutung. Von Halle an der Saale führte die alte Salzstraße über Leipzig und Dresden bis nach Böhmen. Sie quert die höchste Erhebung des Mittelsächsischen Hochlands, in deren Nähe im 13. Jahrhundert Hartha von Franken und Thüringern gegründet wurde. Der Ort, der schon im 16. Jahrhundert über eine bedeutende, bis nach Spanien Handel treibende Leineweberinnung verfügte, gab der bedeutenden Wegkreuzung seinen Namen. Am Harthaer Kreuz trafen die B 175, die B 176 und die S 36 fast senkrecht aufeinander. Die sehr stark befahrene Kreuzung wurde in den 1990er Jahren durch die Anlage von zwei großen Verkehrskreiseln völlig neu gestaltet. Der Charakter eines Verkehrskreuzes wurde damit weitgehend aufgehoben, führte aber zu einer deutlichen Verbesserung des Verkehrsflusses. Der originale Standort der Station 100 – Kreuz wurde beim Bau zerstört. Die Steine des Vermessungspunktes waren vorher abgebaut, gesichert und restauriert worden. Bis 2010 war die Säule am Eingang zum Landesvermessungsamt Sachsen am Olbrichtplatz in Dresden (zeitweise) aufgestellt. Der historische Festpunkt wurde nun in der Nähe seines ursprünglichen Standortes neu errichtet. Er befindet sich nahe dem ursprünglichen Harthaer Kreuz. |
09305350
|

Weitere Bilder |
Ehemaliger Gasthof Zum Kreuz und Nebengebäude |
Hartha Kreuz 2
(Karte) |
Um 1893 (Gasthof); bezeichnet mit 1893 (Nebengebäude) |
Repräsentativer Putzbau mit markantem Dachreiter, regional- und baugeschichtlich bedeutsam sowie von landschaftsprägendem Wert.
- Gasthof: massiv, zweigeschossig, Mittelrisalit mit Dacherker, Porphyrgewände, originale Haustür, Dachvorstand (Schweizer-Haus-Stil), Satteldach, originale Putzreste (Quaderung)
- Nebengebäude: zweigeschossig, massiv, Porphyrgewände, bezeichnet mit 1893 und „A. Richter“
|
09207847
|
 |
Fabrik (ehemals Stahldrahtlitzen- und Webgeschirrfabrik O. Dathe & Co.) |
Heinrich-Heine-Straße 14
(Karte) |
1908 (Fabrik); 1927 (Erweiterungsbau an der Nordseite) |
Putzbauten mit sparsamen Putzgliederungen, die älteren Gebäudeteile auf der Süd- und Westseite über Natursteinsockel in Rochlitzer Porphyrtuff, Nordtrakt von 1927 in Formen der gemäßigten Moderne, markanter Risalit mit Treppenhaus, ursprünglich Herstellung von Stahldrahtlitzen und Webgeschirren, stadtentwicklungs- und industriegeschichtlich sowie baugeschichtlich von Bedeutung |
09307502
|
 |
Wohnhaus in geschlossener Bebauung |
Karl-Marx-Straße 1, 3
(Karte) |
1735 |
Spätbarockes Bürgerhaus, im Ursprung vermutlich zwei Einzelgebäude, aus dem beginnenden 18. Jahrhundert in sehr gutem Originalzustand, zum historischen Stadtkern Harthas gehörend, von großer baugeschichtlicher, stadtentwicklungsgeschichtlicher sowie städtebaulicher Bedeutung. Zweigeschossiger Massivbau mit Mansarddach, klassizistische Tür (1821), teilweise im Erdgeschoss Fenstergewände in Rochlitzer Porphyr, barocke Kartusche mit Inschrift, Fenster, gesamte Ladeneinbauten und Hoffront neu, vor der Sanierung eines der wenigen großen barocken Bürgerhäuser der Stadt. |
08992500
|
 |
Wohnhaus in geschlossener Bebauung |
Karl-Marx-Straße 4
(Karte) |
Nach 1846 |
Schlichter Putzbau aus der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts in gutem Originalzustand, bau- und stadtgeschichtlich von Bedeutung. Zweigeschossiger Massivbau, sehr schöne klassizistisch proportionierte Fenster und Türgewände aus Naturstein, ursprünglich Fenster mit Kniestock, bei Stadtbrand von 1846 abgebrannt und anschließend neu errichtet. |
09248005
|
 |
Wohnhauszeile (ursprünglich Fabrik bzw. Wohn- und Geschäftshäuser) in geschlossener Bebauung (ab 1867 zeitweise Filz- und Schuhwarenfabrik Hermann Müller) |
Karl-Marx-Straße 5, 7, 9, 11
(Karte) |
Um 1850 |
Den Straßenzug prägendes Hausensemble, wesentlich geprägt durch die Überformung 1926 bzw. 1929, orts- und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung. Zweigeschossiger Massivbau mit Zwerchhäusern (um 1905), Fassade zur Straße 1929 und 1926 (Art-déco-Dekor) verputzt, Gewände ursprünglich Rochlitzer Porphyr, steinsichtig, Haustüren mit Facettschliffgläsern 1936, ursprünglich Filz- und Schuhwarenfabrik Hermann Müller ab 1867 (teilweise Kontornutzung) zunächst nur die Nummer 5 und Nummer 9, ab 1929 an Müller auch die Nummer 9 bzw. 11. |
09248007
|
 |
Wohnhaus in geschlossener Bebauung |
Karl-Marx-Straße 12
(Karte) |
Nach 1846 |
Typisches Bürgerhaus des 19. Jahrhunderts mit nachträglichem Ladeneinbau von stadtentwicklungs- und baugeschichtlichem Wert. Zweigeschossiger Massivbau, Fenstergewände im ersten Obergeschoss, Ladeneinbau 1920 Jahre, Tür und Gewände Erdgeschoss um 1895. |
09248006
|
 |
Mietshaus in geschlossener Bebauung |
Karl-Marx-Straße 15
(Karte) |
Um 1865 |
Qualitätvoller Historismusbau mit veränderten Schaufenstern, baugeschichtlich von Bedeutung. Zweigeschossiger Massivbau, verputzt, Bandrustika im Erdgeschoss, Fenster im ersten Obergeschoss mit Zierverdachung und Schlussstein, Hauptgesims mit Putzmäander, Ladeneinbauten im Erdgeschoss verändert, Fenster erneuert. |
09247986
|
 |
Wohn- und Geschäftshaus (Doppelmietshaus) in geschlossener Bebauung |
Karl-Marx-Straße 18, 20
(Karte) |
Um 1905 |
Repräsentativer, das Straßenbild maßgeblich prägender Klinkerbau, baukünstlerische und städtebauliche Bedeutung. Dreigeschossiges Wohn- und Geschäftshaus mit Zwerchhaus, aufwändige neogotische Fenstergewände teilweise mit Wandspiegel, Erdgeschoss teilweise verändert, Fenster erneuert. |
09247996
|
 |
Mietshaus in geschlossener Bebauung, mit Gaststätte „Zum alten Forsthaus“ |
Karl-Marx-Straße 19
(Karte) |
Um 1895 |
Städtebaulich wichtiges Gebäude in Klinkermischbauweise von baugeschichtlichem Wert. Zweigeschossiger Massivbau mit Zwerchgiebel, Erdgeschoss verputzt, Obergeschoss klinkerverkleidet, stuckierte Architekturteile in Neorenaissanceformen, Fenster erneuert. |
09248000
|

Weitere Bilder |
Rathaus (ehemalige Schule) und gärtnerisch gestalteter Vorplatz mit Lindenpflanzung und Brunnen |
Karl-Marx-Straße 32
(Karte) |
1861 (Rathaus); 1913 (Gebäudevorplatz) |
Dreigeschossiges Verwaltungsgebäude in repräsentativen neobarocken Architekturformen, bau- und ortsgeschichtlich und städtebaulich von Bedeutung.
- Rathaus: dreigeschossiger Massivbau von 14 Achsen mit Walmdach und axial angeordnetem Altbau mit zweiläufiger Haupttreppe, Hauptfront über Sockelgeschoss mit Kolossalpilastern, kanneliert, Attika und vier große Rundbogenfenster, achsensymmetrisch Festsaal im dritten Obergeschoss betonend, bei der Sanierung ist die noch um 2000 erhaltene Innenausstattung (wandfest) weitgehend verloren gegangen, beispielsweise wurden die Wandbrunnen abgebrochen, ebenso blieben die nachfolgend aufgezählten, ebenfalls 2000 noch erhaltenen Elemente der historischen Innenausstattung nicht erhalten: Erdgeschoss, erstes Obergeschoss, zweites Obergeschoss ornamentale Bleiverglasung Treppenhaus, Türen, Windfänge, Türklinken, keramische Fußbodenbeläge, Haupttresor und Archivtüren, Festsaal mit Emporen. Ausstattung erneuert.
- gärtnerisch gestalteter Vorplatz: um 1913 beim Umbau des Rathauses neu angelegt, weitgehend original erhalten, mit zwölf Linden (Tilia spec., geschnitten), zwei Rasenflächen mit Einfriedung, Wegeflächen (keramische Platten, rot) und Platzfläche (Großpflaster Granit rot) mit Brunnen (Werkstein); Quelle: Akte Baupolizei im Stadtarchiv Hartha
|
09247975
|
 |
Mietshaus in geschlossener Bebauung und Ecklage |
Karl-Marx-Straße 33
(Karte) |
Um 1860 |
Schlichter Putzbau mit Eckladen, weitgehend original erhalten, baugeschichtlich von Bedeutung. Zweigeschossiger Massivbau mit Zwerchgiebeln, Putzfassadenfronten, Erdgeschoss mit Nutung, mit einfachen Proportionen. |
09247987
|
 |
Wohn- und Geschäftshaus (als Kassenstelle Hartha ehemaliges Bankgebäude der Döbelner Bank und Wohnhaus) in geschlossener Bebauung |
Karl-Marx-Straße 38
(Karte) |
Um 1895 |
Repräsentatives Geschäftshaus in Klinkermischbauweise von bau- und stadtgeschichtlicher Bedeutung. Dreigeschossiger Massivbau mit Erker, viergeschossiger Eckrisalit, Sockelgeschoss rustizierend geputzt, klinkerverkleidet, Fenstergewände, Gesimse aufwändiges Architekturdekor, vermutlich Gewerbebank Döbeln, Filiale Hartha. |
09247997
|
 |
Wohnhaus (ehemaliges Innungshaus der Zeug- und Wollweber) in offener Bebauung |
Kirchgasse 2
(Karte) |
Bezeichnet mit 1795 |
1817–1832 Zunfthaus der Zeug- und Wollweber, orts- und baugeschichtlich von besonderer Bedeutung. Zweigeschossiger Bau, Erdgeschoss massiv, im ersten Obergeschoss Fachwerk, Tür- und Fenstergewände im Erdgeschoss Rochlitzer Porphyr, Fenster und Fachwerk erneuert, in Erfassungsunterlagen von 1952 als ehemaliges „Meisterhaus der Weberinnung“ bezeichnet. |
09248031
|
 |
Häuslerhaus und Schuppen |
Langgasse 15
(Karte) |
Um 1800 |
Weitgehend original erhaltene ländliche Gebäude von sozial-, stadtentwicklungs- und baugeschichtlichem Wert.
- Häuslerhaus: zweigeschossiger Bau, Erdgeschoss massiv, verputzt, erstes Obergeschoss Fachwerk mit Asbest verkleidet, Dachstuhl durch traufseitige Erweiterung verändert – Zeitpunkt der baulichen Erweiterung nicht äußerlich feststellbar, es handelt sich hierbei um eine im 19. Jahrhundert und auch zeitiger übliche Hauserweiterung, die inzwischen durchaus baugeschichtliche Bedeutung erlangt hat
- Seitengebäude oder Schuppen: kleiner eingeschossiger Putzbau mit Satteldach
|
09248029
|

Weitere Bilder |
Ballsaal (Flemmingener Hof) |
Leipziger Straße 1
(Karte) |
Bezeichnet mit 1895 |
Aufwendig gestalteter und weitgehend original erhaltener historischer Ballsaal von baugeschichtlicher, städtebaulicher und ortsgeschichtlicher Bedeutung. Saalbau mit Emporen, gusseiserne Stützkonstruktion, Stuckdecke, Türen, Bleiglasrosetten bauzeitlich. |
09248004
|

Weitere Bilder |
Mietshaus in geschlossener Bebauung |
Leipziger Straße 2
(Karte) |
Um 1890 |
Mit Laden, markanter, das Straßenbild maßgeblich prägender Putzbau mit reicher gründerzeitlicher Fassadengliederung, baukünstlerisch und städtebaulich von Bedeutung. Zweigeschossiger Massivbau, rustizierend verputzt mit klassizistischen Fenstergewänden, Pilastern im ersten Obergeschoss, dreigeschossigem Eckrisalit, stehende Dachgaupen. |
09247983
|
 |
Mietshaus und Einfriedung in Ecklage und offener Bebauung |
Leipziger Straße 20
(Karte) |
Um 1890 |
Baulich leicht überformter Putzbau mit reicher gründerzeitlicher Fassadengliederung, baugeschichtlich und städtebaulich von Bedeutung. Zweigeschossiger Massivbau mit Mansarddach und stehenden Gaupen, verputzt, mit rustizierendem Sockelmauerwerk im Erdgeschoss, Fenstergewände profiliert im ersten Obergeschoss Blumenfestons als Wandspiegel, zwei Nischen, eine mit bauzeitlicher Plastik, bauzeitliche Einfriedung. |
09247982
|
 |
Dreiseithof mit Wohnhaus, Stallgebäude und Scheune (Remise) |
Leisniger Straße 2
(Karte) |
1828 datiert (Bauernhaus); vermutlich 1828 (Seitengebäude und Scheune) |
Kleine Hofanlage, im frühen 19. Jahrhundert außerhalb des Stadtkerns neu erbaut, in gutem Originalzustand, bau- und stadtentwicklungsgeschichtlich von Bedeutung |
09248010
|
 |
Wohnhaus (ehemaliges Armenhaus) |
Leisniger Straße 12
(Karte) |
Nach 1821 |
Schlichter Fachwerkbau, als Wohnhaus für in Armut lebende Bürger der Stadt Hartha in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts erbaut, sozial- und ortsgeschichtlich von Bedeutung. Zweigeschossiger Bau, Erdgeschoss Massivbau, im ersten Obergeschoss Fachwerk (neu aufgeschraubt), Fenster mit Türgewänden Rochlitzer Porphyr, Sockel neu gefasst. |
09248009
|

Weitere Bilder |
Ehemaliges Rathaus |
Markt 1
(Karte) |
Um 1840 |
Markanter Putzbau an der Schmalseite des Marktes, als ehemaliges Rathaus der Stadt von großer ortsgeschichtlicher Bedeutung. Zweigeschossiger Massivbau mit Mittelrisalit, verputzt, mit Walmdach, klassizistische Fenster- und Türgewände, Rochlitzer Porphyr, Supraporte mit Harthaer Stadtwappen, Fenster, Türen usw. erneuert. |
08992479
|
 |
Ehemaliges Brauhaus |
Markt 2a
(Karte) |
Bezeichnet mit 1731 |
Mit dem Rathaus verbundener repräsentativer Putzbau mit prägender Toreinfahrt und zwei Dachhechten, ortsgeschichtlich, baugeschichtlich und städtebaulich von Bedeutung. Zweigeschossiger Massivbau, verputzt, im Erdgeschoss Fenster- und Türgewände Rochlitzer Porphyr, Rundbogenportal mit Schlussstein und Kartusche, Fenster und Giebelfront erneuert, heute Stadtbibliothek. |
08992487
|

Weitere Bilder |
Wohnhaus in geschlossener Bebauung |
Markt 8
(Karte) |
Um 1790 |
Repräsentatives Bürgerhaus mit doppelläufiger Treppe und Altan, baugeschichtlich und ortsbildprägend von Bedeutung. Zweigeschossiger Massivbau auf Souterrain, Fenster- und Türgewände erneuert (um 1925), Altan auf Doppelsäulen mit zweiläufiger Treppe, an Altanbrüstung Reliefdarstellung Putto, Fenster haltend mit Kartusche und Zimmerei – Werkzeug (um 1925), weitere Kartusche Darstellung nicht erhalten, Haus zwischen 2003 und 2014 saniert, dabei Originalbestand gewahrt. |
08992481
|
 |
Türstock |
Markt 9
(Karte) |
Um 1840 |
Schlichter zeittypischer Türstock aus Rochlitzer Porphyrtuff von baugeschichtlichem Wert, klassizistischer Türstock |
08992504
|
 |
Wohnhaus in geschlossener Bebauung |
Markt 10, 12
(Karte) |
Um 1750 |
Repräsentatives Bürgerhaus mit vorgelagerter zweiläufiger Treppe, baugeschichtlich, ortsgeschichtlich und platzbildprägend von Bedeutung. Zweigeschossiger Massivbau, verputzt, Fenstergewände dekorativ verputzt (1920er Jahre), Türgewände mit Schlussstein und barocker Kartusche, doppelläufige Treppe, erneuert, ursprünglich handelte es sich um zwei Gebäude, welche später zu einem Gebäude zusammengefasst wurden. |
08992486
|
 |
Türstock |
Markt 11
(Karte) |
Bezeichnet mit 1839 |
Zeittypisches Portalgewände aus Rochlitzer Porphyrtuff, baugeschichtlich von Bedeutung. Klassizistischer Türstock mit waagerechter Verdachung auf geschweiften Konsolen, am Türstock bezeichnet mit „Hennig 1839“, 1931 wohnte im Haus der Bäckermeister Emil Hennig. |
08992505
|
 |
Türportal eines Wohnhauses |
Markt 13
(Karte) |
Um 1850 |
Zeittypisches Portalgewände aus Rochlitzer Porphyrtuff, vergleichbar den anderen Portalen der Marktbebauung, Zeugnis der Baukultur von baugeschichtlichem Wert. Zweigeschossiger Massivbau, verputzt, Bandrustika im Erdgeschoss, Fenster- und Türgewände Porphyr, Sandstein, Rückfront erneuert, ebenso Fenster, Krüppelwalmdach mit stehenden Gaupen (Neubau 1992). |
09305514
|
 |
Wohnhaus, ehemaliger Gasthof, in geschlossener Bebauung |
Markt 17
(Karte) |
Um 1840 |
Breit lagernder Putzbau mit nachträglich eingebauten Läden, stadtentwicklungsgeschichtlich und platzprägend von Bedeutung. Zweigeschossiger Massivbau, verputzt, klassizistische Türstöcke, Fenstergewände im Erdgeschoss und teilweise Türstöcke in Rochlitzer Porphyr, stehende Gaupen (um 1840), dekorativer Putz (um 1925), Fenster, Türen, Ladeneinbauten erneuert. |
08992483
|
 |
Wohnhaus in geschlossener Bebauung |
Markt 18
(Karte) |
Bezeichnet mit 1730 |
Den Marktplatz prägender, baulich leicht überformter Putzbau von stadtentwicklungs- und baugeschichtlicher Bedeutung. Zweigeschossiger Massivbau, verputzt, Fenster- und Türgewände neu (bis auf Schlussstein mit Inschrift 1730), Fenster und Türen sowie Rückfront erneuert. |
08992492
|
 |
Wohnhaus in geschlossener Bebauung |
Markt 19
(Karte) |
Um 1840 |
Repräsentatives, den Marktplatz maßgeblich prägendes Bürgerhaus, stadtentwicklungs- und baugeschichtlich von Bedeutung. Zweigeschossiger Massivbau, verputzt, auf Bruchsteinsockel, klassizistische Türstöcke, natursteingefasst, desgl. Fenstergewände im Erdgeschoss, vermutlich unter Zusammenlegung zweier Hausgrundstücke neu oder umgebautes Bürgerhaus, vermutlich bereits zur Bauzeit mit Laden, Fassade geprägt durch die regelmäßige Reihung der Rechteckfenster im Obergeschoss, bauzeitlich sind beide Türportale, prägend der die gesamte Dachfläche einnehmende Dachhecht. |
08992484
|
 |
Wohnhaus in geschlossener Bebauung |
Markt 20
(Karte) |
Um 1850 / nach 1842 |
Vermutlich nach dem Stadtbrand von 1842 neu erbautes Bürgerhaus mit leicht überformter Fassade, baugeschichtlich, ortsentwicklungsgeschichtlich und platzbildprägend von Bedeutung. Zweigeschossiges Wohnhaus, Massivbau, verputzt, Fenstergewände und Türportal nicht erhalten, geschweiftes Satteldach mit Hechtgaube, Fassadendekoration 1920er Jahre, vermutlich gehört das Gebäude zu den älteren Häusern der Marktbebauung, welches möglicherweise nach dem Stadtbrand von 1842 unter Einbeziehung älterer Teile eines Vorgängerbaus neu errichtet oder umgebaut wurde. |
09305515
|
 |
Wohnhaus in geschlossener Bebauung |
Markt 21
(Karte) |
Um 1800 |
Bürgerhaus mit Art-déco-Dekorationen über den Fenstern, den Marktplatz mit prägender Putzbau von bau- und stadtentwicklungsgeschichtlichem Wert. Zweigeschossiger Massivbau, verputzt, Türgewände in Rochlitzer Porphyr mit Schlussstein (bezeichnet mit 1928 – Bezeichnung Portal vermutlich nachträglich), Fenstergewände in dekorativer Putzfassung (wohl 1928), stehende Dachgaupen (um 1895), Fenster, Türen, Ladeneinbauten erneuert, erbaut vermutlich um 1800, Überformung um 1928. |
08992485
|
 |
Türportal eines Wohnhauses |
Markt 25
(Karte) |
Anfang 19. Jahrhundert |
Spätbarockes Türportal aus Rochlitzer Porphyrtuff in traditioneller Gestaltung, regionalgeschichtlich von Bedeutung, klassizistischer Türstock |
08992506
|
 |
Wohnhaus in geschlossener Bebauung |
Markt 27, 27a
(Karte) |
Um 1750 |
Unter Zusammenfassung mehrerer Wohnhäuser entstandener breitlagernder Putzbau mit nachträglichen Ladeneinbauten, den Marktplatz maßgeblich prägend, stadtentwicklungsgeschichtlich und städtebaulich von Bedeutung. Zweigeschossiger Massivbau, Erdgeschoss mit Ladeneinbauten (um 1930), Fenster- und Türgewände mit Naturstein gefasst, Gaupenbau (um 1930), vermutlich wurden beim Bau bzw. Umbau des Hauses mehrere Grundstücke zusammengelegt, wodurch das Gebäude zum größten Gebäude des Marktplatzes wurde. |
08992490
|
 |
Wohnhaus in geschlossener Bebauung |
Markt 30
(Karte) |
Um 1850 |
Schlichtes Bürgerhaus, als Bestandteil der historischen Marktplatzbebauung von orts- sowie baugeschichtlichem Wert. Zweigeschossiger Massivbau, Rückfront Fachwerk, teilweise verputzt, Zwerchgiebel, Fenster erneuert. |
08992496
|
 |
Wohnhaus in geschlossener Bebauung |
Markt 33
(Karte) |
Um 1800 |
Spätbarockes Bürgerhaus, vermutlich mit verputztem Fachwerk im Obergeschoss, als wichtiger Bestandteil der Marktplatzbebauung stadt- sowie baugeschichtlich von Bedeutung. Zweigeschossiger Massivbau, Fenster- und Türgewände im Erdgeschoss Rochlitzer Porphyr. |
08992491
|
 |
Wohnhaus in geschlossener Bebauung |
Markt 36
(Karte) |
Bezeichnet mit 1836 |
Spätbarockes Bürgerhaus mit verputztem Fachwerk im Obergeschoss und reizvollen Art-déco-Dekorationen über den Fenstern im Erdgeschoss, baugeschichtlich, städtebaulich und stadtentwicklungsgeschichtlich von Bedeutung. Zweigeschossiger Massivbau, verputzt, Türgewände mit Schlussstein (datiert 1836), Fenstergewände dekorativ verputzt (um 1920) Fachwerk (schieferverkleidet), mit Krüppelwalmdach. |
08992495
|
 |
Wohnhaus |
Markt 40
(Karte) |
2. Hälfte 18. Jahrhundert (eventuell älter) |
Wohl zu den ältesten Häusern des Marktplatzes gehörend, nicht in der gleichen Flucht mit der übrigen Marktbebauung stehend und in seiner Gestaltung von dieser sich unterscheidend. ortsentwicklungsgeschichtlich, städtebaulich und baugeschichtlich von Bedeutung. Zweigeschossiger Bau, im ersten Obergeschoss beider Traufseiten Fachwerk (schieferverkleidet bzw. verbrettert), mit Krüppelwalmdach, zurückversetzt stehend, in der Gestaltung anders als die übrige Marktbebauung, sehr hohes Dach, Fenster unmittelbar unter der Traufe, es ist anzunehmen, dass das Gebäude wohl zu den ältesten noch erhaltenen Häusern in Hartha gehört. |
08992494
|
 |
Wohnhaus in Ecklage und geschlossener Bebauung |
Nordstraße 2, 2a
(Karte) |
1886 |
Zeittypischer Mietshausbau, städtebaulich und baugeschichtlich von Wert. Zweigeschossiger Massivbau, verputzt, im Erdgeschoss Nutung, streng gefasste Fenster- und Türgewände mit schlichter Plinthe, Satteldach mit stehenden Gauben. |
08992503
|
 |
Mietshaus in geschlossener Bebauung in Ecklage |
Pestalozzistraße 11
(Karte) |
Um 1900 |
Markantes Eckhaus in Klinkermischbauweise, bau- und stadtentwicklungsgeschichtlich von Bedeutung. Zwei-, teils dreigeschossiger Massivbau mit Eckrisalit und Zwerchgiebel und stehenden Gaupen, Erdgeschoss verputzt mit Nutung, Obergeschoss klinkerverkleidet, farbig alternierend, Fenster teils mit Verdachung und ornamentaler Stuckierung. |
09248001
|
 |
Mietshaus in geschlossener Bebauung |
Pestalozzistraße 12
(Karte) |
Um 1905 |
Als einzigartiges ausgeprägtes Beispiel des floralen Jugendstils in Hartha von baugeschichtlicher und ortsbildprägender Bedeutung. Dreigeschossiger Massivbau mit Erker, viergeschossiger Eckrisalit, Sockelgeschoss rustizierend geputzt, klinkerverkleidet, Fenstergewände, Gesimse aufwändiges Architekturdekor. |
09247999
|
 |
Mietshaus in geschlossener Bebauung |
Pestalozzistraße 16
(Karte) |
Um 1905 |
Putzbau mit zeittypischer Fassadendekoration, weitgehend authentisch erhalten, von stadtentwicklungsgeschichtlichem und baugeschichtlichem Wert. Dreigeschossiger Massivbau auf Bruchsteinsockel, Zwerchgiebel, ornamentaler Fassadenschmuck, Supraporte (Eule), Fenster erneuert. |
09247998
|
 |
Mietshaus in geschlossener Bebauung |
Pestalozzistraße 18
(Karte) |
Um 1905 |
Zeittypischer, durch den Jugendstil beeinflusster Bau in Klinkermischbauweise, baukünstlerisch und geschichtlich von Bedeutung. Zweigeschossiger Massivbau mit Zwerchhaus, verputzt und teils klinkerverkleidet, Fenster- und Türgewände Werkstein bzw. geputzt, bauzeitliche Haustür, Fenster erneuert. |
09248015
|
 |
Haustor (Toreinfahrt) |
Pestalozzistraße 21
(Karte) |
Um 1890 |
Authentisch erhaltenes Baudetail eines Mietshauses in handwerklich solider Ausführung, baugeschichtlich von Bedeutung. Türstock mit Beschlagwerksornamentik, typisches Beispiel qualitätvoller Tischlerarbeit in Neorenaissanceformen. |
08992502
|

Weitere Bilder |
Schule (Pestalozzi-Schule, ehemalige Bürgerschule), Turnhalle, Einfriedung, Freigelände um die Schule (Gartendenkmal) sowie Gehwege um die Schule (Pestalozzistraße, Richard-Wagner-Straße, Südstraße) |
Pestalozzistraße 27
(Karte) |
1900–1901 |
Drei- bzw. viergeschossiger Bau in teils repräsentativen neobarocken- und Neorenaissanceformen mit weitgehend erhaltener wandfester Ausstattung, Turnhalle als Saalbau mit Emporeneinbau in gleicher Gestaltung, parkartige Grünanlagen und bauzeitlicher Einfriedung, baugeschichtlich, ortsgeschichtlich und städtebaulich von Bedeutung.
- Schule: Schuleinweihung laut stadtgeschichtlicher Literatur am 16. November 1902, dreigeschossiger bzw. viergeschossiger Massivbau auf Sockelgeschoss, repräsentativer Mittelrisalit mit flankierenden Seitenrisaliten mit genuteter Fassadenfront, Segmentbogenfenstern und Kolossalpilastern (Sandstein bzw. Putz), Haupteingänge von toskanischen Säulen mit Gebälk flankiert, Rundbogenfenster mit ornamentalen Zwickelfeldern, sandsteingefasster Okulus mit Uhr über Hauptgesims, Seitenflügel mit Segmentbogenfenstern, wohl ursprünglich klinkerverkleidet, um 1927 farbig verputzt, Hofansicht Klinker in Rot, bauzeitliche Ausstattung (wandfest) u. a.: stuckierte Treppenhäuser, Mosaikfußböden, Türlaibungen, Treppengeländer, Haupteingangs- und Zimmertüren, Fenster erneuert
- Turnhalle: massiver Saalbau mit übergiebeltem Mittelrisalit, klinkerverkleidet mit geputzten Eckquaderungen und Segmentbogenfenstern in Naturstein (mit Glasbausteinen zugesetzt)
- Einfriedung: Natursteinsockel mit aufwändigen Pfeilern in Klinkermauerwerk (verdacht) mit schmiedeeisernen Zaunfeldern, an der nördlichen Grundstücksgrenze Klinkermauer, Zugangstore: aufwändig gestaltetes Haupttor an der Pestalozzistraße, Nebenzugangstore: ein doppelflügliges Ziergittertor an der Richard-Wagner-Straße, zwei doppelflüglige Ziergittertore an der Südstraße
- Freianlagen: parkartige Grünanlage mit regelmäßigem Wegesystem, zum Teil Klinkerbelag, teilweise wassergebundenen Decken, Baumreihe aus Winter-Linden (Tilia cordata) entlang der Grundstücksgrenze an der Pestalozzistraße, Reste einer Baumreihe aus Winter-Linden entlang der Grundstücksgrenze an der Heinrich-Heine-Straße, Baumraster aus sechs Winter-Linden nördlich und südlich des Seitenflügels, nördliches Baumraster nur noch drei Bäume vorhanden, außerdem Altbaumbestand aus u. a. Rot-Buche (Fagus sylvatica), Stiel-Eiche (Quercus robur) und Rosskastanie (Aesculus hippocastanum)
- Pflasterung Gehwege: Belag aus Fitschener Platten auf den Gehwegen entlang der Pestalozzistraße, Richard-Wagner-Straße und Südstraße
|
09247967
|
 |
Ehemaliges Postamt und Einfriedung |
Pestalozzistraße 29
(Karte) |
Zwischen 1903 und 1904 (Post); um 1904 (Einfriedung) |
Repräsentativer Klinkerbau von bau- und ortsgeschichtlicher Bedeutung. Zweigeschossiger Massivbau mit Natursteinsockel, neogotischer Zwerchgiebel, Fenster mit Natursteingewände, bauzeitlicher Fahnenhalter, Einfriedung mit Natursteinsockel, Pfeilern und schmiedeeisernen Zäunen. |
09247976
|
 |
Mietshaus in geschlossener Bebauung |
Pestalozzistraße 30
(Karte) |
Bezeichnet mit 1896 |
Mit Laden, Klinkermischbau mit Fassadendekorationen im Stil der Neorenaissance, baulich leicht vereinfacht, stadtentwicklungs- und baugeschichtlich von Bedeutung. Zweigeschossiger Massivbau mit Zwerchgiebel und stehende Gaupen, Sockelgeschoss verputzt mit Nutung (teilweise verändert), Obergeschoss mit farbigen Klinkern verkleidet, Architekturteile in Neorenaissanceformen. |
09248021
|
 |
Villa mit Einfriedung |
Pestalozzistraße 31
(Karte) |
Bezeichnet mit 1903 (Villa); um 1905 (Einfriedung) |
Putzbau mit historisierendem Fassadendekor, stadtentwicklungs- und baugeschichtlich von Bedeutung. Zwei-, teils dreigeschossiger Massivbau mit Eckrisalit auf Sockelgeschoss, Eckquaderungen, teils Fensterverdachungen mit Ornamentik, Haus vor 2014 saniert. |
09248119
|
 |
Mietshaus in geschlossener Bebauung |
Pestalozzistraße 32
(Karte) |
Bezeichnet mit 1896 |
Zeittypischer, baulich leicht überformter Bau in Klinkermischbauweise, stadtentwicklungs- und baugeschichtlich von Bedeutung. Zweigeschossiger Massivbau mit Zwerchgiebel und stehende Gaupen, Sockelgeschoss verputzt und verändert, Obergeschoss mit farbigen Klinkern verkleidet, Architekturteile in Neorenaissanceformen. |
09248020
|
 |
Villa |
Pestalozzistraße 33
(Karte) |
1903/1904 |
Villa des ehemaligen Fahrzeugfabrikanten Emil Faust, orts- und baugeschichtlich von Bedeutung. Zweigeschossiger Massivbau, Natursteinsockel verputzt mit Klinker, Fenstergewände neogotisch – Jugendstil, Bauherr war Tiefbauunternehmer Dathe, späterer Eigentümer Emil Faust, Fahrzeugfabrikant (Quelle: Stadtarchiv Hartha). |
09248118
|
 |
Mietshaus in geschlossener Bebauung |
Pestalozzistraße 34
(Karte) |
Um 1895 |
Zweifarbiger Klinkerbau mit Putzstuckdekorationen aus den 1920er Jahren, stadtentwicklungs- und baugeschichtlich von Bedeutung. Zweigeschossiger Massivbau mit Zwerchgiebel und Blendarkade, Sockelgeschoss verputzt (um 1920), Obergeschoss mit farbigen Klinkern verkleidet, dort über Fenstern rundbogige Bleiglasfelder, stuckiert, im Erdgeschoss Putzstuckdekorationen: Fruchtkörbe auf gedrehten Säulen sowie Namenszug des damaligen Eigentümers: „Karl Hänsel“, originale Haustür. |
09248019
|
 |
Wohnhaus mit Garten und Einfriedung |
Pestalozzistraße 35
(Karte) |
1905–1906 (Wohnhaus); 1906 (Einfriedung) |
Ortsgeschichtlich, bau- und gartenkünstlerisch sowie städtebaulich von Bedeutung. 1905 Bau eines Wohnhauses auf dem Flurstück 230 für den Filzwarenfabrikanten Oskar Fein durch O. Krauspe; 1906 Errichtung eines Hintergebäudes (B. Fröhlich) und Einfriedung (O. Krauspe); 1926 Erweiterung der Anlage um das Flurstück 231f – Fortsetzung der Einfriedung und vermutlich Gartengestaltung; 1938 Abputz und Dachgeschossausbau am Wohnhaus (C. Reinschüssel) im Auftrag des Eigentümers Alfred Oemig.
- Wohnhaus: zweigeschossiger Massivbau in offener Bebauung mit Zwerchgiebeln und Mansarddach, über Porphyrsockel verputzte Fassadenfronten (verändert) und Fenstern (erneuert) mit Natursteingewände, baukünstlerisch äußerst qualitätvolle, bauzeitliche Ausstattung: Treppenhausgeländer mit Kandelaber, das Gebälk tragende Karyatiden im Erdgeschoss, Fußbodenkacheln in floralen Formen des Jugendstils, Haus- und Wohnungstüren mit figürlichen und ornamentalen Ätzverglasungen, Kachelöfen, florale und lineare Stuckaturen in den Deckenbereichen der Wohnungsdielen und -zimmer
- Hintergebäude: eingeschossiger Massivbau mit Pultdach, Fenster und Türen mit Natursteingewänden gefasst, verputzte Fassadenfronten (teilweise verändert)
- Garten: von der ursprünglichen Anlage sind erhalten (s. hierzu gartendenkmalpflegerische Bestandserfassung):
- Einfriedung inklusive Mauern und Pfeiler (Ziegelmauerwerk mit grauem Spezialputz), Sockel (Zyklopenmauerwerk, Rochlitzer Porphyr) sowie Zaunfelder und Tore (Ziergitter), Wege- und Platzflächen und deren Beläge (Einfahrt Großpflaster Granit, Eingänge weißrotes Seifensteinpflaster, ursprünglich alle Gartenwege, Solnhofer Platten mit Reststücken originaler Betonzierkante)
- struktur- und raumbildende Bepflanzung: Eine Hänge-Esche (Frasinius excelsior ‚Pludula‘) als Laubenbaum, zwei geschnittene Linden an der Einfahrt, eine Trauer-Weide (Salixalba ‚Tristis‘) und Blütensträucher wie Rhododendron, Pfeifenstrauch (Philadelphus), Schneebeere (Symphoricarpos) und Flieder (Syringa), Ausstattungselemente wie Reste eines Pavillons (Fundamente) und einer Pergola (Fundamente der Pfosten), vier Pflanzgefäße (Unterbau Ziegel mit grauem Spezialputz, Pflanzgefäß Beton) und Wasserbecken (Beton); Quelle: Stadtarchiv Hartha, Baupolizeiamt, Bauakte Pestalozzistraße 35
|
09247972
|
 |
Wohn- und Geschäftshaus in geschlossener Bebauung in Ecklage |
Pestalozzistraße 36
(Karte) |
Um 1900 |
Zeittypischer, weitgehend original erhaltener Klinkerbau, baugeschichtlich, städtebaulich und ortsentwicklungsgeschichtlich von Bedeutung. Zwei-, teils dreigeschossiger Massivbau, klinkerverkleidet, aufwändige stuckierte Fassadengliederung in Neorenaissanceformen. |
09248024
|
 |
Mietshaus in geschlossener Bebauung |
Pestalozzistraße 41
(Karte) |
Um 1900 |
Klinkermischbau in Neorenaissanceformen, baugeschichtlich von Bedeutung. Zweigeschossiger Massivbau mit Zwerchgiebel, Sockelgeschoss verputzt, Klinker, Haustor bauzeitlich, Fenster erneuert, stehende Gaupen. |
09247980
|
 |
Mietshaus in geschlossener Bebauung |
Pestalozzistraße 42
(Karte) |
Um 1905 |
Zeittypisches Wohnhaus in Klinkermischbauweise, baugeschichtlich, ortsentwicklungsgeschichtlich und städtebaulich von Bedeutung. Zweigeschossiger Massivbau, teils klinkerverkleidet, mit Zwerchgiebel, Sockel mit Porphyr verkleidet, Fenster erneuert, Haustür bauzeitlich. |
09248023
|
 |
Mietshaus in geschlossener Bebauung |
Pestalozzistraße 43
(Karte) |
Um 1900 |
Zeittypischer Klinkermischbau in Neorenaissanceformen, Teil eines zeitgleich entstandenen Straßenzuges, baugeschichtlich, ortsentwicklungsgeschichtlich und städtebaulich von Bedeutung. Zweigeschossiger Massivbau mit Zwerchgiebel, Sockelgeschoss verputzt, Klinker, Haustor um 1910, stehende Gaupen, vor 2014 denkmalgerecht saniert. |
09247979
|
 |
Mietshaus in geschlossener Bebauung |
Pestalozzistraße 46
(Karte) |
Um 1900 |
Zeittypisches Wohnhaus in Klinkermischbauweise, baugeschichtlich, ortsentwicklungsgeschichtlich und städtebaulich von Bedeutung. Zweigeschossiger Massivbau, teils klinkerverkleidet, mit Zwerchgiebel, Sockel mit Porphyr verkleidet, Fenster erneuert, Haustür bauzeitlich.
Breit lagerndes Gebäude in Klinkermischbauweise. Im Erdgeschoss ursprünglich mit Laden und seitlichem Tor (zur Garage umgebaut). Die Fenster und Türen wurden durch zeittypische Gewände mit geometrischen Verzierungen aus Werkstein eingefasst. Das Obergeschoss und der Frontgiebel wurden mit roten Klinkern verblendet. Zwischen den Fenstern, die Horizontale des Hauses betonend, wurden Klinkerbänder aus dunkelrot glasierten Klinkern angeordnet. Auch die Fenster des Obergeschosses wurden mit zeittypischen, qualitätvoll gestalteten Werksteingewänden versehen. eine ähnliche Gestaltung weist auch der Frontgiebel auf. Das Gebäude ist Teil eines annähernd zeitgleich entstandenen Straßenzuges, der durch sein einheitliches Erscheinungsbild beeindruckt. Das Haus dokumentiert gemeinsam mit der Nachbarbebauung eindrucksvoll die sog. „Baumeisterarchitektur“ des beginnenden 20. Jahrhunderts sowie die städtebauliche Entwicklung Harthas im Zusammenhang mit der Industrialisierung. Aus beidem ergibt sich die stadtentwicklungsgeschichtliche und baugeschichtliche Bedeutung des Hauses. |
09305517
|
 |
Mietshaus in geschlossener Bebauung |
Pestalozzistraße 47
(Karte) |
Um 1902 |
Qualitätvoller Putzbau in Jugendstilformen, baugeschichtlich, ortsentwicklungsgeschichtlich und städtebaulich von Bedeutung. Zweigeschossiger Massivbau mit Zwerchgiebel (geschweift) verputzt, Tor bauzeitlich, Fenster erneuert, liegende Dachgaupen |
09247978
|
 |
Mietshaus in geschlossener Bebauung |
Pestalozzistraße 48
(Karte) |
1901 datiert |
Traditionelles Wohnhaus in Klinkermischbauweise, Teil eines gleichartigen Straßenzuges, baugeschichtlich, ortsentwicklungsgeschichtlich und städtebaulich von Bedeutung. Zweigeschossiger Massivbau, teils klinkerverkleidet, mit Zwerchgiebel, Sockel mit Porphyr verkleidet, Fenster erneuert. |
09248022
|
 |
Mietshaus in geschlossener Bebauung |
Pestalozzistraße 52
(Karte) |
Um 1905 |
Weitgehend original erhaltener Putzbau mit zeittypischen Fassadendekorationen, baukünstlerisch, baugeschichtlich und städtebaulich von Bedeutung. Zweigeschossiger Massivbau, verputzt mit Zwerchgiebel (mit Zapfen), floral gefasster Hauptgesims, aufwändige Fenstergewände, teilweise mit Wandspiegel, bauzeitliche Eingangstür. |
09248018
|
 |
Mietshaus in geschlossener Bebauung |
Pestalozzistraße 56
(Karte) |
Um 1890 |
Sachlich gestalteter Putzbau mit Deckenmalerei im Treppenhaus, baugeschichtliche und künstlerische Bedeutung. Zweigeschossiger Massivbau mit Zwerchgiebel, Erker und Walmdach, Fenster, Fassaden erneuert, Hausflur: Art-deco-Deckenmalerei mit Tierkreiszeichen und weiblichen Allegorien, wohl von Kunstmaler Hans Moller, Dresden, mit Deckenleuchte und Zwischentür um 1928 (Quelle Stadtarchiv Hartha). |
09247984
|
 |
Mietshaus in geschlossener Bebauung |
Pestalozzistraße 68
(Karte) |
Um 1905 |
Zeittypisches Wohnhaus in Klinkermischbauweise in gutem Originalzustand von baugeschichtlichem, stadtentwicklungsgeschichtlichem und städtebaulichem Wert. Türstock mit Beschlagwerksornamentik, typisches Beispiel qualitätvoller Tischlerarbeit in Neorenaissanceformen. Zeittypisches Mietshaus in Klinkermischbauweise. Zweigeschossig mit fünf Fensterachsen im Obergeschoss. Hauseingang in der Mittelachse des Hauses, zurückgesetzt über eine Vortreppe zu erreichen. Die originale Haustür blieb erhalten. Das Obergeschoss wurde mit orangen Klinkern verblendet und mit roten Klinkerbändern gegliedert. Die Fenster wurden durch Klinkerformsteine (Stabprofilierung) eingefasst und gestalterisch durch kleine Reliefs mit Köpfchen und wappenartiger Darstellung hervorgehoben. Den Abschluss des Hauses bildet ein schiefergedecktes Satteldach mit großem vierachsigem Dacherker und kleinen Gauben seitlich.
Das Haus ist Teil eines gleichzeitig entstandenen Straßenzuges in weitgehend einheitlicher Gestaltung. Der Straßenzug dokumentiert eindrucksvoll die im Zusammenhang mit der Industrialisierung stehende rasante Entwicklung der Stadt Hartha, woraus sich die stadtgeschichtliche Bedeutung auch des Einzelhauses ableitet. Der gute Originalzustand des Hauses ermöglicht einen eindrucksvollen Einblick in die sogenannten „Baumeisterarchitektur“ des beginnenden 20. Jahrhunderts, so dass dem Gebäude auch ein baugeschichtlicher Wert beizumessen ist. |
09305516
|

Weitere Bilder |
Kirche und Friedhof Hartha (Sachgesamtheit) |
Pfarrgasse
(Karte) |
1908 (Einweihung Neuer Friedhof) |
Sachgesamtheit Kirche und Friedhof Hartha mit folgenden Einzeldenkmalen: Kirche mit Ausstattung und Einfriedung (09248114) sowie der Friedhofskapelle, den Kriegerdenkmalen der Kriege 1870/1871, 1914–1918, 1939–1945, dem Denkmal für Martin Luther und verschiedenen Gräbern (09247970), der gärtnerischen Friedhofsanlage (Gartendenkmal) sowie der Luther-Buche und der Siegeseiche (beide Gartendenkmale); qualitätvoll gestaltete Friedhofsanlage mit für die Stadtgeschichte bedeutsamen Denkmälern und Grabmälern, stadtgeschichtliche, künstlerische sowie gartenkünstlerische Bedeutung. Die Ursprünge reichen vermutlich in die Zeit der ersten Stadtkirche, die bereits 1506 abbrannte, mehrfach erweitert, in den Äquidistantenkarten 1874 noch ohne Friedhofskapelle und mit L-förmigen Grundriss, im Meilenblatt von 1821 mit Nachträgen bis 1876 in den Äquidistantenkarten von 1890 schon zu rechteckiger Grundriss erweitert, 1907 und 1912 nun mit der 1893 erbauten Kapelle, in den Messtischblättern von 1921, 1922 und 1939 Erweiterung auf die heutige Ausdehnung erkennbar, 1893 mit Eisengitterzaun umgrenzt sowie mit zwei Toren ausgestattet, 1897 nach Plänen des Landschaftsgärtners Otto Moßdorf aus Leipzig (auch Entwurf des Palmengartens in Leipzig) teilweise neu angelegt und mit Pflanzengruppen ausgeschmückt (Quelle: Georg Buchwald (Hrsg.): Neue sächsische Kirchengalerie. Band 10: Ephorie Leisnig. Leipzig 1900. Sp. 455–456.)
Friedhofsgestaltung: Hauptzugang über Treppenanlage und doppelflügliges Ziergittertor im Westen der Kirche, weiterer Zugang südöstlich der Kirche, regelmäßiges Wegesystem mit teilweise geraden, teilweise in Bögen geführten Wegen und wassergebunden Decken, Hauptweg vom Zugang südöstlich der Kirche nach Norden an der Kapelle vorbei führend, südlich der Kapelle mit Resten einer Lindenreihe (Tilia spec.) bestanden, nördlich der Kapelle mit Allee aus Spitz-Ahorn (Acer platanoides), nördlich der Allee Querweg mit Allee aus Spitz-Ahorn (Acer platanoides), entlang der westlichen Friedhofsgrenze Allee aus Winter-Linden (Tilia cordata), nördlich der Kirche abgestorbene Trauer-Esche (Fraxinus excelsior ‚Pendula‘), in verschiedenen Bereichen Rhododendron-Bestände. |
09305441
|

Weitere Bilder |
Kirche mit Ausstattung und Einfriedung (Einzeldenkmal der Sachgesamtheit 09305441) |
Pfarrgasse
(Karte) |
1868–1870 (Kirche); Anfang 16. Jahrhundert (Schnitzfiguren); 1871 (Altar); 1897 (farbige Bleiglasfenster); 1911 (Orgel) |
Einzeldenkmal der Sachgesamtheit Kirche und Friedhof Hartha; ortsbildprägende neoromanische Hallenkirche von baugeschichtlicher, künstlerischer und geschichtlicher Bedeutung. 14. April 1868–13. November 1870 (Entwurf und Ausführung der Kirche), Massivbau (Naturstein) als große, dreischiffige Hallenkirche mit flachem Satteldach, Fassadenfronten des Schiffes mit Wandpfeilern, Rundbogenfenstern und darüberliegenden Zwerggalerien mit Zwillings- bzw. Drillingsfenstern, neoromanischen Doppelsäulen und Würfelkapitellen, eingezogener Westturm mit Zeltdach und ursprünglich flankierenden Turmfialen, Hauptportal als Rundbogen mit Rosette und Supraporte (Relief mit Verkündigungsengel), Hallenraum mit gusseisernen Säulen und überhöhten Kuppelgewölben teils mit Rippenbögen, umlaufende eingeschossige Empore, Kanzel auf Bündelpfeiler von Gotthilf Ludwig Möckel, 28 künstlerisch bedeutende Bleiglasfenster, Apsis mit Geburt, Auferstehung Christi und Ausgießung des hl. Geistes, obere Nordseite mit vier großen Propheten, obere Südseite mit vier Evangelisten, mittlere Emporenfenster Nordseite mit Philipp Melanchthon, Ulrich von Hutten und Friedrich dem Weisen, mittlere Emporenfenster Südseite mit Martin Luther, Johann dem Beständigen und Franz von Sickingen, untere Nordseite mit Gleichnis der zehn Jungfrauen, untere Südseite mit acht Ereignissen aus dem Leben Jesu, ursprünglich neoromanischer Altar mit Retabel (Möckel), Reliefplastik der Grablegung Christi aus carrarischem Marmor (Schwenk, Broßmann) bekrönt von einem Ciborium und vier flankierenden Apostelstatuen, (Möckel, Schwenk, Broßmann), Orgel der Firma Eule, Bautzen, 1910, Altarorgel, Firma Schuke, Potsdam, 1982, nach Außenrenovierung 1933–1935 natursteinsichtige Außenfronten der Kirche und des Turmes, nach Innenrenovierung 1959–1962 vereinfachte Ausmalung, 1970 u. a. Beseitigung der Altarretabel (Grablegung Christi heute in der Turmhalle) und zeitgenössische Ausstattung des Altarraumes, ebenda barocke Grabplatte von Familie Plenikowski. |
09248114
|
 |
Friedhofskapelle und Kriegerdenkmale der Kriege 1870/1871, 1914–1918, 1939–1945 sowie diverse Grabstätten und Denkmal von Martin Luther (Einzeldenkmale der Sachgesamtheit 09305441) |
Pfarrgasse
(Karte) |
1873 (Kriegerdenkmal Deutsch-Franz. Krieg und Lutherdenkmal); 1893 (Friedhofskapelle); zwischen 1914 und 1940 (Grabmale); 1989 (Kriegerdenkmal Zweiter Weltkrieg) |
Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Kirche und Friedhof Hartha; stadtgeschichtliche und künstlerische Bedeutung.
- Friedhofskapelle: neoromanischer Klinkerbau (verputzt) mit Empore, Bleiverglasungen (1920er Jahre), Kapelle um 1893 erbaut, wohl um 1935 umgestaltet (Verputz, neues Rundbogenportal mit Inschrift: „Friede sei mit Euch“)
- Grabmale:
- Franz Hermann Müller (1916), Filzwarenfabrikant
- Grabmal Familie Kipping (östliche Friedhofsmauer)
- ehemaliges Grabmal Abel Hoffmann (1973), neu belegt und ergänzt durch Familie Kehl, bezeichnet mit „R. Pohlert, Bildhauer, Dresden. 1914“
- nicht auffindbar 2014: Ernst Arthur Fein (28. Februar 1923), Stadtrat und Fabrikbesitzer
- Kriegerdenkmale:
- Kriegerdenkmal 1870/1871 mit Skulptur einer Germania, datiert: 2. September 1873
- Kriegergedenkstätte 1914–1918: Obelisk mit Relief „Tröstender Christus mit kniender Frau“, weinend, flankiert von je vier Gedenktafeln mit Namen in Rochlitzer Porphyr, mit Wegeverbindung und Sitzbank, Entwurf von Oswin Hempel, Gedenkstein: Selmar, Werner (beide Dresden), Gedenktafeln: Steinmetzmeister Haberkorn (Rochlitz), hinter dem Obelisk Stiel-Eiche (Quercus robur)
- Kriegergedenkstätte 1939–1945: Hochkreuz mit liegenden Gedenktafeln, 1989
- Denkmale/Gedenkbäume:
- Denkmal mit Skulptur Martin Luther, um 1873
- „Siegeseiche“ – Friedenseiche 1871 zum Gedenken an Deutsch-Französischen Krieg
- „Lutherbuche“, 1883, Hainbuche (Carpinus betulus)
- weitere bauliche Anlagen:
- Treppenanlage zum Markt (erneuert)
- Einfriedung, Zyklopenmauerwerk aus Porphyr mit schmiedeeisernen Ziergittern
|
09247970
|
 |
Wohnhaus |
Steinaer Straße 2
(Karte) |
Bezeichnet mit 1827 |
Ländliches Wohnhaus mit verkleidetem bzw. verputztem Fachwerkobergeschoss in gutem Originalzustand, hausgeschichtlich, sozialgeschichtlich und ortsentwicklungsgeschichtlich von Bedeutung. Zweigeschossiger Bau, Erdgeschoss massiv, erstes Obergeschoss Fachwerk, verputzt bzw. verkleidet, Stichbogenportal mit Schlussstein aus Rochlitzer Porphyrtuff, Krüppelwalmdach. |
09248032
|
 |
Wohnhaus in geschlossener Bebauung (heute Gaststätte Silbertal) |
Steinaer Straße 11
(Karte) |
Bezeichnet mit 1846 |
Zeittypischer Putzbau in gutem Originalzustand, bau- und ortsentwicklungsgeschichtlich von Bedeutung. Zweigeschossiger Massivbau, verputzt, Krüppelwalmdach mit originalem Dachhecht, klassizistische Tür- und Fenstergewände, sehr schlichter zeittypischer Bau, welcher das Bauhandwerk und die Lebensverhältnisse seiner Entstehungszeit anschaulich dokumentiert. |
09248033
|
 |
Türportal mit Schlussstein |
Steinaer Straße 16
(Karte) |
Bezeichnet mit 1798 |
Zeittypisches Portalgewände eines Wohnhauses aus dem ausgehenden 18. Jahrhundert von stadtentwicklungsgeschichtlichem und baugeschichtlichem Wert |
09248030
|
 |
Wohnhaus in geschlossener Bebauung |
Steinaer Straße 23
(Karte) |
Um 1730 |
Breit lagernder Putzbau über 12 Achsen mit bauzeitlichem Portalgewände und zwei übereinander angeordneten Dachhechten, bau- und ortsentwicklungsgeschichtlich von Bedeutung. Zweigeschossiger Massivbau, verputzt mit Fenster- und Türgewände, Naturstein – 2014 überputzt, teils verändert und erneuert, zwei Dachhechte, möglicherweise ursprünglich bis zu vier Wohnhäuser, welche später zu einem Gebäude zusammengefasst wurden. |
09248027
|
 |
Diakonatsgebäude |
Steinaer Straße 25
(Karte) |
1890 |
Ursprünglich vermutlich zweigeschossiger Putzbau mit dreigeschossigem Seitenrisalit in zeittypischer Bauweise, bau- und ortsgeschichtlich von Bedeutung. 1890 als Diakonat erbaut. Ursprünglich vermutlich zweigeschossiger Putzbau mit dreigeschossigem Seitenrisalit, später aufgestockt. Das weitgehend authentisch erhaltene Gebäude wird geprägt durch eine zeittypische Rustikagliederung im Erdgeschoss, einen Natursteinsockel sowie Gurt- und Fensterbankgesimse und Fensterverdachungen mit waagerechtem Gebälk bzw. Dreieckgiebel. Die Haustür blieb original erhalten, die Fenster wurden vorbildgerecht erneuert. Im Inneren des Hauses befand sich der Konfirmandensaal (heute Gemeindesaal), der auch zu Armenkommunionen und Abendandachten benutzt wurde. Die Baukosten des Hauses betrugen 24.000 Mark. Das Gebäude wird bis heute durch die Kirche genutzt. Neben der baugeschichtlichen Bedeutung als exemplarisches Beispiel des Bauhandwerks des ausgehenden 19. Jahrhunderts ergibt sich der Denkmalwert auch aus der ortsgeschichtlichen Bedeutung als eines der wichtigsten kirchlichen Gebäude der Stadt Hartha. |
09248026
|
 |
Wohnhaus (ursprünglich zwei Wohnhäuser) in geschlossener Bebauung |
Steinaer Straße 29
(Karte) |
1846 datiert |
Zeittypische Bürgerhäuser aus der Mitte des 19. Jahrhunderts in zeittypischer Ausprägung, bau- und ortsentwicklungsgeschichtlich von Bedeutung. Zweigeschossige Massivbauten, verputzt, Fenster- und Türgewände aus Rochlitzer Porphyr, Fenstergewände im Erdgeschoss beider Häuser weisen die für die 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts typische Hohlkehle zur Aufnahme der Winterfenster auf, Ladeneinbau verändert, beide Gebäude wurden heute unter einer Hausnummer zusammengefasst. |
09248025
|
 |
Wohnhaus in offener Bebauung mit Einfriedung und Garten |
Südstraße 2, 4
(Karte) |
1923 bis 1926 (Wohnhaus); 1926 (Einfriedung) |
Neobarockes repräsentatives Doppelwohnhaus mit Gestaltungselementen des Art dèco, einer der bedeutendsten Wohnbauten großbürgerlichen Anspruchs in der Stadt Hartha mit weitestgehendem bauzeitlichen Erhaltungszustand, baukünstlerische und städtebauliche Bedeutung.
- Wohnhaus: Bauherr war Fabrikbesitzer Wilhelm, Drahtlitzenfabrikant, zweigeschossiger Massivbau mit schiefergedecktem Mansarddach in repräsentativen neobarocken Formen, offene, großzügige Loggien auf der Gartenfront
- Einfriedung: bauzeitlicher Holzzaun mit Sockel aus Zyklopenmauerwerk und Pfosten aus verputztem Ziegelmauerwerk
- Garten: Baumreihe aus drei Winter-Linden (Tilia cordata) entlang der Grundstücksgrenze südlich des Hauses, drei Rosskastanien (Aesculus hippocastanum) nördlich des Hauses
|
09247971
|
 |
Wohnhaus in offener Bebauung |
Weststraße 10
(Karte) |
Um 1895, später überformt |
Vermutlich im ausgehenden 19. Jahrhundert erbautes Wohnhaus mit prägender Fassadenüberformung in den 1920er Jahren von bau- und stadtentwicklungsgeschichtlichem Wert. Zweigeschossiger Massivbau, verputzt mit Zwerchgiebel, Tor- und Fenstergewände mit Korbbögen, teils mit floralem Eierstab gefasst, Tor und Fenster erneuert.
Um 1895 erbautes, einzeln stehendes Mietshaus. Vermutlich in den 1920er Jahren Neugestaltung der Fassade mit qualitätvollen Art-déco-Dekorationen. Frei stehender zweigeschossiger Putzbau, 4 × 2 Achsen, abgeschlossen durch ein Satteldach. Das Haus wird heute im Wesentlichen geprägt durch die Fassadengestaltung der 1920er Jahre, dabei insbesondere durch die Fenstereinfassungen, wie beispielsweise die durch Gesimse verbundenen Fenster im Obergeschoss oder die dekorative Einfassung der seitlichen Haustür. Der Sockel aus Natursteinen sowie die Fenstergrößen und die Anordnung der Fenster sind dagegen bauzeitlich. Das Haus vereint in sich Gestaltungselemente der Erbauungszeit und des Umbaus. Vermutlich gehörte das Haus zu den ersten in dem um 1900 vermutlich neu angelegten Straßenzug und dokumentiert damit gemeinsam mit der Nachbarbebauung die städtebauliche Entwicklung Harthas infolge der Industrialisierung im ausgehenden 19. Jahrhundert recht eindrucksvoll. Zugleich erlangt das Haus durch die genannte qualitätvolle Gestaltung das Bauhandwerk beider Bauphasen Zeugniswert des Bauhandwerks. Der Denkmalwert ergibt sich danach vorrangig aus der stadtentwicklungsgeschichtlichen und baugeschichtlichen Bedeutung des Hauses. |
09305518
|
 |
Mietshaus in geschlossener Bebauung |
Weststraße 23
(Karte) |
Um 1900 |
Zeittypischer Bau in Klinkermischbauweise mit aufwendiger Fassadengestaltung in gutem Originalzustand, bau- und ortsentwicklungsgeschichtlich von Bedeutung. Zweigeschossiger Massivbau, verputzt mit Zwerchgiebel, Tor- und Fenstergewände mit Korbbögen, teils mit floralem Eierstab gefasst, Tor und Fenster erneuert.
Das Gebäude zeichnet sich durch eine aufwendige, authentisch erhaltene Fassadengliederung aus. Das Erdgeschoss wird durch eine Rustikagliederung, die kräftig vortretenden Sohlbänke, gestützt durch pfeilerartige Vorlagen, sowie Diamantquader in den Brüstungsfeldern der Fenster und den in Form von Diamantquadern ausgebildeten Schlusssteinen geprägt. Die Haustür blieb original erhalten. Durch rote Klinkerverblender wurde die Obergeschossfassade verkleidet, welche durch Putzgesimse gegliedert wird. Weiterhin prägend für die Fassade sind die Fenstergewände mit vorkragenden Sohlbänken und Verdachungen. Die Fensterbrüstungen zwischen den Stützkonsolen der Sohlbänke wurden mit Balustern dekoriert. Den oberen Abschluss des Hauses bildet ein ebenfalls kräftig ausgebildetes Kranzgesims mit Stützkonsolen. Der leicht vortretende Seitenrisalit mit Dreieckgiebel weist die gleichen Gestaltungselemente auf. Das Gebäude gehört unzweifelhaft zu den besterhaltenen Mietshäusern des Straßenzuges und zeichnet sich durch eine besonders typische und original erhaltene Gestaltung aus. Damit ergibt sich der Denkmalwert dieses Mietshauses aus dem baugeschichtlichen sowie dem stadtentwicklungsgeschichtlichen Wert. |
09305519
|
 |
Mietshaus in geschlossener Bebauung |
Weststraße 27
(Karte) |
Um 1905 |
Zeittypischer Putzbau mit Toreinfahrt in gutem Originalzustand, bau- und ortsentwicklungsgeschichtlich von Bedeutung. Zweigeschossiger Massivbau, verputzt mit Zwerchgiebel, Tor- und Fenstergewände mit Korbbögen, teils mit floralem Eierstab gefasst, Tor und Fenster erneuert. |
09248013
|

Weitere Bilder |
Wohnhaus in halboffener Bebauung |
Weststraße 29
(Karte) |
Um 1900 |
Aufwendig gegliedertes Gebäude in Klinkermischbauweise, baugeschichtlich von Bedeutung. Zweigeschossiger Massivbau auf Natursteinsockel, Erdgeschoss mit Bandrustika geputzt, im ersten Obergeschoss verkleideter Klinker, Seitenrisalit mit Zwerchgiebel, Fenster erneuert, Eingangstor bauzeitlich. |
09248012
|
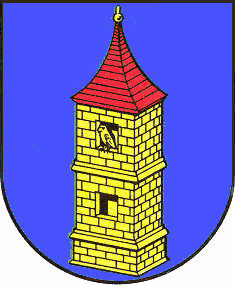

 führt zu den Angaben des Kulturdenkmals bei Wikidata.
führt zu den Angaben des Kulturdenkmals bei Wikidata.