Top-Fragen
Zeitleiste
Chat
Kontext
Liste der 1933 bis 1938 nach österreichischem Recht Hingerichteten
Wikimedia-Liste Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Remove ads
Die Liste der 1933 bis 1938 nach österreichischem Recht Hingerichteten bietet einen Überblick über jene 45 Personen, die aufgrund der Rechtslage zur Todesstrafe in der Zeit zwischen dem 10. November 1933 (Verhängung des Standrechts in Österreich durch die Regierung Dollfuß II) und dem März 1938 („Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich) in Österreich zum Tode verurteilt und hingerichtet („justifiziert“) wurden. Alle 45 Hingerichteten waren Männer; nach dem 1933 bis 1938 in Österreich geltenden Recht war auch die Hinrichtung von Frauen möglich, doch ist es im genannten Zeitraum dazu nicht gekommen.
Remove ads
Rechtliche Grundlagen
Zusammenfassung
Kontext
In der 1918 gegründeten Republik Österreich galt zunächst noch ein aus der Habsburgermonarchie stammendes Notverordnungsrecht, das die Todesstrafe für eine Reihe von Delikten vorsah.
Die Verfassung der Republik Österreich von 1920 sah die Todesstrafe im ordentlichen Verfahren nicht mehr vor. Die Vorschriften des Strafgesetzes von 1852 betreffend das standrechtliche Verfahren blieben davon jedoch unberührt.
1933 bis 1. Mai 1934
Unter dem seit Frühjahr 1933 mittels Verordnungen autoritär regierenden Bundeskanzler Engelbert Dollfuß (CSP) wurde in der Ministerratssitzung vom 10. November 1933 die Verhängung des Standrechts in Österreich beschlossen, wodurch im Fall mehrerer Delikte wieder die Todesstrafe entsprechend dem Strafgesetz von 1852 verhängt werden konnte;[1] der entsprechende Beschluss trat am nächsten Tag in Kraft. Standrechtliche Verfahren waren seither vorgesehen für die Delikte des Mordes, der Brandlegung sowie für das Verbrechen der öffentlichen Gewalttätigkeit, und zwar gegen Personen, die auf frischer Tat ergriffen wurden oder deren Schuld ohne Verzug feststellbar war.[2]

Nach den gesetzlichen Vorgaben wurden standrechtliche Verfahren von einem aus vier Richtern und einem Staatsanwalt bestehenden „fliegenden Senat“ geführt, der am Oberlandesgericht Wien seinen Sitz hatte und falls notwendig zum zuständigen Landes- bzw. Kreisgericht anreiste. Die Verhandlungsdauer betrug im standrechtlichen Verfahren längstens drei Tage, wobei der Prozess entweder mit einem Freispruch oder mit der Todesstrafe zu enden hatte. Betrug die voraussichtliche Verfahrensdauer mehr als drei Tage, so musste der Fall vor einem ordentlichen Gericht verhandelt werden, welches jedoch keine Todesurteile verhängen konnte. Das standrechtliche Verfahren hingegen endete bei einstimmiger Bejahung der Schuldfrage mit der Verurteilung zum „Tode durch den Strang“. Gegen das Urteil eines Standgerichtes war kein Rechtsmittel zulässig, einzig eine Begnadigung zu lebenslanger Haft durch den Bundespräsidenten war möglich, wenn ein Gnadengesuch gestellt wurde und das Justizministerium dieses dem Bundespräsidenten vorlegte. Unterblieb ein entsprechendes Gnadengesuch oder wurde es vom Bundespräsidenten abgelehnt, so war das Todesurteil nach regulär zwei Stunden am Würgegalgen zu vollstrecken. Auf Antrag des Verurteilten konnte die Hinrichtung um eine weitere Stunde (die sogenannte „dritte Stunde“) aufgeschoben werden. Aufgrund dieser engen Zeitvorgaben reiste der „fliegende Senat“ meist bereits zusammen mit dem Scharfrichter und dessen Assistenten zum Verhandlungsort an.

Nach der Verkündung eines Todesurteils wurden unverzüglich die Vorbereitungen für den Vollzug der Strafe getroffen, d. h. der Verurteilte wurde in einer Todeszelle isoliert, geistlicher Beistand und eine Henkersmahlzeit angeboten, letzte Besuche organisiert und der Würgegalgen errichtet. Traf bis spätestens drei Stunden nach Verkündung des Todesurteils keine Nachricht über die erfolgte Begnadigung ein, so wurde das Urteil vollstreckt. Scharfrichter bei den weitaus meisten Hinrichtungen zwischen 1933 und 1938 war Johann Lang aus Wien, ein Neffe des 1925 verstorbenen kaiserlichen Scharfrichters Josef Lang. Ihm zur Seite standen zwei Assistenten, der Fiakerfahrer Josef Bors und der Fleischwaren-Markthändler Franz Spitzer. Hinrichtungen wurden auch von anderen Henkern durchgeführt, z. B. in den Fällen von Josef Ahrer, Josef Stanek, Anton Bulgari und Koloman Wallisch.
Der erste Prozess im standrechtlichen Verfahren fand am 14. Dezember 1933 in Wels statt, wobei das Todesurteil auf Empfehlung des Justizministers jedoch vom Bundespräsidenten in eine Freiheitsstrafe umgewandelt wurde.[3] Ein standrechtliches Gerichtsverfahren war auch der zu Jahresbeginn 1934 in Graz geführte Prozess gegen Peter Strauß, wobei Justizminister Kurt Schuschnigg das am 11. Jänner 1934 gefällte Todesurteil erstmals vollstrecken ließ. Die zivilen Standgerichte auf der 1933 geschaffenen rechtlichen Grundlage kamen besonders nach den „Februarkämpfen 1934“ zum Einsatz. Per Notverordnung wurde vom 12. bis zum 21. Februar 1934 auch das Verbrechen des „Aufruhrs“ gemäß §§ 73, 74 StG 1852 der Standgerichtsbarkeit unterworfen,[4] so dass Personen, die im Zuge der Kämpfe bewaffnet gefangen genommen worden waren, zum Tode verurteilt werden konnten.[5] Die im Eilverfahren abgewickelten Prozesse – überwiegend gegen Aktivisten der Sozialdemokratischen Partei und des Republikanischen Schutzbundes – endeten mit 24 Todesurteilen, von denen 15 in Haftstrafen umgewandelt[6] und 9 vollstreckt wurden.
1. Mai 1934 bis 1938
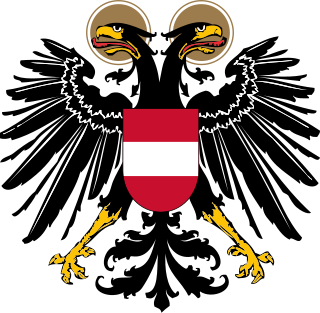
Mit der am 1. Mai 1934 in Kraft getretenen „Maiverfassung“ wurde die Republik Österreich auch formalrechtlich zu einem autoritären Staat (siehe Ständestaat, Austrofaschismus) umgestaltet; bis zum „Anschluss“ an das Deutsche Reich im März 1938 hieß der Staat nun offiziell Bundesstaat Österreich. Am 19. Juni 1934 führte eine Gesetzesänderung die Todesstrafe auch im ordentlichen Verfahren wieder ein.[7] Am 12. Juli 1934 wurde den österreichischen Standgerichten auch die Zuständigkeit für Vergehen im Zusammenhang mit Sprengstoffattentaten und dem illegalen Besitz von Sprengstoff übertragen.[2]
Beim „Juliputsch“ am 25. Juli 1934 verübten SS-Männer, die als Soldaten des Bundesheeres und Polizisten verkleidetet waren, einen Überfall auf das Bundeskanzleramt in Wien, in dessen Verlauf Bundeskanzler Dollfuß getötet wurde. Gleichzeitig drang eine andere Gruppe von nationalsozialistischen Aktivisten in die Senderäume der RAVAG ein. Nach dem Scheitern des Putschversuchs wurde einen Tag später das „Bundesverfassungsgesetz vom 26. Juli 1934 über die Einführung eines Militärgerichtshofes als Ausnahmsgerichtes zur Aburteilung der mit dem Umsturzversuch vom 25. Juli 1934 im Zusammenhang stehenden strafbaren Handlungen“[8] erlassen, wodurch zusätzlich zu den bereits existierenden zivilen Standgerichten auch ein militärisches Standgericht geschaffen wurde. Der auf diese Weise ins Leben gerufene Militärgerichtshof ähnelte in Zusammensetzung, Verfahrensführung und Kompetenzen den zivilen Standgerichten, außer dass beim Militärgericht vier Offiziere als Richter fungierten. Die nach dem Juliputsch verhafteten Personen wurden von der Staatsanwaltschaft in „schwer“ und „minder Beteiligte“ geschieden. Die Schwerbeteiligten (Anführer, Mitkämpfer, Kuriere usw.) wurden auch dann dem Militärgericht zur Aburteilung ihrer mit dem Putsch im Zusammenhang stehenden Vergehen überstellt, wenn ein Verfahren gegen sie bereits vor einem ordentlichen Gericht oder einem zivilen Standgericht anhängig war. Die abermals im Eilverfahren abgewickelten Prozesse gegen die Beteiligten des Juliputsches, von denen viele aus den Reihen der Exekutive sowie des Bundesheeres gekommen waren, endeten mit zahlreichen Todesurteilen, von denen 13 vollstreckt wurden.
Nach dem „Anschluss“ Österreichs im März 1938 ähnelte die Rechtslage zur Todesstrafe der des Deutschen Reiches.
Remove ads
Liste vollstreckter Todesurteile
Zusammenfassung
Kontext
Die folgende Tabelle listet jene Personen auf, die 1933 bis 1938 durch österreichische Gerichte – sowohl in Anwendung des Standrechts als auch im ordentlichen Verfahren – zum Tode verurteilt und hingerichtet wurden.[9]
Bei einer großen Anzahl von Todesurteilen erfolgte eine Umwandlung in Haftstrafen: Im Zeitraum zwischen den „Februarkämpfen“ im Februar 1934 und dem „Anschluss“ im März 1938 wurden in Österreich 141 Todesurteile ausgesprochen, von denen 44 vollstreckt wurden.[10] Allein im „Galgenhof“ des Landesgerichtes Wien wurden im genannten Zeitraum 21 Hinrichtungen am Würgegalgen durchgeführt. Im Jahr 1936 verhängten österreichische Gerichte 18 Todesurteile (Geschworenengerichte 14, Standgerichte 4), von denen zwei vollstreckt wurden; im Jahr 1937 verhängten österreichische Gerichte 30 Todesurteile (Geschworenengerichte 23, Standgerichte 7), von denen 9 vollstreckt wurden.[11] Unter den 1933 bis 1938 nach österreichischem Recht zum Tode verurteilten und hingerichteten Menschen war Anton Bulgari (1877–1934) mit 57 Jahren der älteste, Fritz Fleck (1917–1937) mit 19 Jahren der jüngste. Die 45 Hingerichteten lassen sich nach den Gründen, die zu ihrer Verurteilung zum Tode führten, grob in vier Gruppen einteilen: 10 Personen waren Anhänger der österreichischen Sozialdemokratie, von denen die meisten Anfang 1934 im Zusammenhang mit den Februarkämpfen hingerichtet wurden; 15 Personen waren Nationalsozialisten, von denen die meisten im Sommer 1934 im Zusammenhang mit dem Juliputsch hingerichtet wurden; 19 Personen wurden aufgrund von Mordfällen ohne politischen Hintergrund hingerichtet; lediglich Peter Strauß lässt sich als Urheber einer Brandstiftung, bei der ausschließlich Sachschaden entstand, keiner der anderen drei Kategorien zuweisen.
Martin Scherer (* 1899) aus St. Georgen bei Salzburg, der für eine Reihe von Vergehen (Giftmord in Bruck an der Glocknerstraße, Brandstiftung, Versicherungsbetrug sowie Anstiftung weiterer Personen zu schweren Straftaten) am 11. November 1937 durch ein Geschworenengericht in Salzburg nach österreichischem Recht zum Tode verurteilt worden war, wurde erst am 24. September 1938, also nach dem „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich, hingerichtet (siehe dazu die Liste von im Deutschen Reich hingerichteten Personen). Da Todesurteile im Deutschen Reich zu dieser Zeit mit dem Fallbeil vollstreckt wurden,[49] ist davon auszugehen, dass die Hinrichtung Scherers durch Enthaupten erfolgte.
Remove ads
Aufteilung nach Ort und Zeit
(Hinrichtungen im Zusammenhang mit den „Februarkämpfen“ 1934 sind mit einem „†“ gekennzeichnet, solche im Zusammenhang mit dem „Juliputsch“ 1934 mit einem „‡“.)
- Niederösterreich – 6 Hinrichtungen
- Krems, Kreisgericht: Pritz (1937), Eder (1937).
- St. Pölten, Kreisgericht: Rauchenberger (1934†), Hois (1934†).
- Wiener Neustadt, Kreisgericht: Schlögl (1937), Fleck (1937).
- Oberösterreich – 6 Hinrichtungen
- Linz, Landesgericht: Bulgari (1934†), Leitner (1936), Strigl (1937), Scheinecker (1937).
- Ried im Innkreis, Kreisgericht: Einböck (1937).
- Steyr, Gefangenenhaus: Ahrer (1934†).
- Salzburg – 1 Hinrichtung
- Salzburg, Landesgericht: Neudorfer (1935).
- Steiermark – 9 Hinrichtungen
- Graz, Landesgericht: Strauß (1933), Stanek (1934†), Neubauer (1935), Weichselbaum (1936), Fuchs (1937).
- Leoben, Kreisgericht: Wallisch (1934†), Erlbacher (1934‡), Ebner (1934‡), Bogensperger (1935).
- Tirol – 2 Hinrichtungen
- Innsbruck, Landesgericht: Wurnig (1934‡), Eibl (1938).
- Wien – 21 Hinrichtungen
- Wien, Landesgericht: Münichreiter (1934†), Weissel (1934†), Swoboda (1934†), Gerl (1934), Holzweber (1934‡), Planetta (1934‡), Feike (1934‡), Wohlrab (1934‡), Hackl (1934‡), Leeb (1934‡), Maitzen (1934‡), Domes (1934‡), Saureis (1934‡), Unterberger (1934‡), Bendinger (1934), Fleischer (1934), Gaidosch (1934), Pribauer (1935), Böck (1935), Sedlak (1935), Dörr (1937).
Gräber
- Grab von Karl Münichreiter († 1934) im Urnenhain der Feuerhalle Simmering
- Grab von Georg Weissel († 1934) auf dem Wiener Zentralfriedhof
- Grabstein für Emil Swoboda († 1934) im Urnenhain der Feuerhalle Simmering
- Grabstein für Viktor Rauchenberger und Johann Hois († 1934) auf dem Hauptfriedhof St. Pölten
- Grab von Josef Stanek († 1934) auf dem Grazer Zentralfriedhof
- Grab von Josef Ahrer († 1934) im Urnenfriedhof am Tabor in Steyr
- Grabdenkmal der Freiheitskämpfer 1934, unter ihnen Koloman Wallisch, auf dem Friedhof St. Ruprecht in Bruck/Mur
- Grab von Anton Bulgari († 1934) auf dem St. Barbara-Friedhof in Linz
- Grab von Josef Gerl († 1934) im Urnenhain der Feuerhalle Simmering
- Grab von Otto Planetta († 1934) auf dem Dornbacher Friedhof
- Unmarkiertes Grab von Ernst Feike († 1934) auf dem Wiener Zentralfriedhof
- Unmarkiertes Grab von Josef Hackl († 1934) auf dem Wiener Zentralfriedhof
- Grab von Franz Leeb († 1934) auf dem Wiener Zentralfriedhof
- Grab von Johann „Hans“ Domes († 1934) auf dem Dornbacher Friedhof
Remove ads
Siehe auch
Literatur
- Peter Lais: Die Anwendung der Todesstrafe in Österreich von Ende 1933 bis Ende 1934. Darstellung und Analyse ausgewählter Fälle, Diplomarbeit an der Karl-Franzens-Universität Graz, Graz 2018 (PDF, online)
- Winfried R. Garscha: Opferzahlen als Tabu. Totengedenken und Propaganda nach Februaraufstand und Juliputsch 1934. In: Ilse Reiter-Zatloukal, Christiane Rothländer, Pia Schölnberger (Hrsg.): Österreich 1933–1938. Interdisziplinäre Annäherungen an das Dollfuß-/Schuschnigg-Regime. Böhlau, Wien 2012, S. 111–128.
- Wilhelm Weinert: Die Wiedereinführung der Todesstrafe 1933, in: Die Geschichte des Grauen Hauses und der österreichischen Strafgerichtsbarkeit, h.g. vom Bibliotheksverein im Landesgericht für Strafsachen Wien, Wien 2012 (PDF, 91 Seiten), S. 80–81.
- Martin Polaschek: Todesstrafe und Todesurteile in Österreich 1933 bis 1938, in: Die Geschichte des Grauen Hauses und der österreichischen Strafgerichtsbarkeit, h.g. vom Bibliotheksverein im Landesgericht für Strafsachen Wien, Wien 2012 (PDF, 91 Seiten), S. 82–87.
- Harald Seyrl (Hrsg.): Die Erinnerungen des österreichischen Scharfrichters. Erweiterte, kommentierte und illustrierte Neuauflage der im Jahre 1920 erschienenen Lebenserinnerungen des k.k. Scharfrichters Josef Lang. Edition Seyrl, Wien 1996, ISBN 3-901697-02-0.
Remove ads
Weblinks
- Über die Todesstrafe in der 1. Republik ( vom 6. Februar 2006 im Internet Archive) (Wiener Zeitung)
- „… wird mit dem Tode bestraft!“ (PDF; 151 kB) In: Öffentliche Sicherheit. Das Magazin des Innenministeriums, Nr. 5–6/2010
- Foto des „Galgenhofes“ im Landesgericht für Strafsachen Wien mit Fundamenten für Würgegalgen (Bildarchiv Austria)
- Foto des „Galgenhofes“ im Landesgericht für Strafsachen Wien bei einer Gedenkfeier zur Zeit des Nationalsozialismus
- Foto der „Armesünderzelle“ (Todeszelle) im Landesgericht für Strafsachen Wien
- Foto eines Würgegalgens, der auch 1933 bis 1938 im Landesgericht für Strafsachen Wien verwendet wurde
- Website mit Foto des Grabes von Franz Holzweber († 1934) auf dem Friedhof Mauer in Wien
Remove ads
Einzelnachweise
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads













