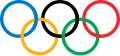Top-Fragen
Zeitleiste
Chat
Kontext
Olympische Sommerspiele 1952/Leichtathletik
Wettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1952 Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Remove ads
Bei den XV. Olympischen Spielen 1952 in der finnischen Hauptstadt Helsinki fanden 33 Wettkämpfe in der Leichtathletik statt.
Remove ads
Teilnehmer
Nachdem bei den Olympischen Spielen 1948 bedingt durch die Nachwirkungen des Zweiten Weltkriegs Deutschland und Japan noch von der Teilnahme ausgeschlossen waren, durften sie in Helsinki wieder dabei sein. Außerdem entsandte jetzt auch die Sowjetunion Teilnehmer, die gleich sehr erfolgreich auftraten. Insgesamt gab es 1342 gemeldete Leichtathleten – 267 Frauen und 1011 Männer – aus 57 Nationen.[1]
Remove ads
Stadion
Austragungsort war das Olympiastadion von Helsinki, erbaut von 1934 bis 1936 im Hinblick auf die eventuelle Austragung der Olympischen Spiele 1940, die dann nach Tokio vergeben worden und schließlich kriegsbedingt ganz ausgefallen waren. Für die Austragung der Leichtathletikwettbewerbe hatte man eine Aschenbahn als 400-Meter-Rundbahn angelegt. Diese befand sich trotz schlechter Witterungsbedingungen mit häufig teilweise heftig auftretenden Regenfällen in durchgängig guter Verfassung.
Das Stadion fasste rund 70.000 Zuschauer und hatte erstmals eine elektronische Anzeigetafel vorzuweisen. Das erleichterte dem Publikum das Verfolgen der Disziplinen und der Ergebnisse erheblich.[2]
Remove ads
Wettbewerbe
Das Wettbewerbsangebot war identisch mit dem der letzten Spiele in London. Es gab 24 Disziplinen im Männerbereich und neun für die Frauen, die sich immer noch mit drei Einzellaufangeboten – 100 Meter, 200 Meter und 80 Meter Hürden – begnügen mussten. Weiterhin gab es keine einzige Mittel- oder Langstrecke. Im Laufbereich wurde darüber hinaus nur noch die 4-mal-100-Meter-Staffel ausgetragen. Mit Hoch- und Weitsprung gab es weiterhin zwei Sprungdisziplinen sowie mit Kugelstoßen, Diskus- und Speerwurf drei Stoß-/Wurfwettbewerbe. An diesem Programm änderte sich auch bei den kommenden Spielen 1956 nichts. Erst 1960 wurde zusätzlich der 800-Meter-Lauf für die Frauen wieder ins olympische Programm genommen.
Sportliche Erfolge
Zusammenfassung
Kontext
Das Leistungsniveau brachte insgesamt noch einmal eine deutliche Steigerung gegenüber den vorangegangenen Großveranstaltungen. In der Fachzeitschrift 'Leichtathletik' war zu lesen, dass die Leistungen oberhalb der Grenzen liegen, die ein Mensch sich vorstellen könne. So gab es in zehn Disziplinen fünfzehn egalisierte oder neue Weltrekorde und eine Weltbestleistung. In 24 Disziplinen gab es darüber hinaus 41 neue oder egalisierte olympische Rekorde.[3]
- Weltrekorde im Einzelnen:
- 4-mal-400-Meter-Staffel, Männer: 3:03,9 min – Jamaika (Arthur Wint, Leslie Laing, Herb McKenley, George Rhoden), Finale
- Dreisprung, Männer: 16,12 m – Adhemar da Silva (Brasilien), Finale
- Dreisprung, Männer: 16,22 m – Adhemar da Silva (Brasilien), Finale
- Hammerwurf, Männer: 60,34 m – József Csermák (Ungarn), Finale
- Zehnkampf, Männer: 7887 P (1952er Wertung) / 7580 P (1985er Wertung) – Bob Mathias (USA)
- 100-Meter-Lauf, Frauen: 11,5 s – Marjorie Jackson (Australien), Halbfinale
- 100-Meter-Lauf, Frauen: 11,5 s – Marjorie Jackson (Australien), Finale
- 200-Meter-Lauf, Frauen: 23,6 s (egalisiert) – Marjorie Jackson (Australien), Vorlauf
- 200-Meter-Lauf, Frauen: 23,4 s (egalisiert) – Marjorie Jackson (Australien), Halbfinale
- 80-Meter-Hürdenlauf, Frauen: 11,0 s (egalisiert) – Shirley Strickland (Australien), Vorlauf
- 80-Meter-Hürdenlauf, Frauen: 10,9 s – Shirley Strickland (Australien), Finale
- 4-mal-100-Meter-Staffel, Frauen: 46,1 s – Australien (Shirley Strickland, Verna Johnston, Winsome Cripps, Marjorie Jackson) Finale
- 4-mal-100-Meter-Staffel, Frauen: 45,9 s – USA (Mae Faggs, Barbara Jones, Janet Moreau, Catherine Hardy) Finale
- 4-mal-100-Meter-Staffel, Frauen: 45,9 s – Deutschland (Ursula Knab, Maria Sander, Helga Klein, Marga Petersen), Finale
- Kugelstoßen, Frauen: 15,28 m – Galina Sybina (Sowjetunion), Finale
- Weltbestleistung:
- 3000-Meter-Hindernislauf, Männer: 8:45,4 min – Horace Ashenfelter (USA) Finale
- Olympische Rekorde im Einzelnen:
- 200-Meter-Lauf, Männer: 20,7 s (egalisiert) – Andy Stanfield (USA), Finale
- 400-Meter-Lauf, Männer: 45,9 s – George Rhoden (Jamaika), Finale
- 400-Meter-Lauf, Männer: 45,9 s – Herb McKenley (Jamaika), Finale
- 800-Meter-Lauf, Männer: 1:49,2 min – Mal Whitfield (USA), Finale
- 1500-Meter-Lauf, Männer: 3:45,2 min – Josy Barthel (Luxemburg), Finale
- 1500-Meter-Lauf, Männer: 3:45,2 min – Bob McMillen (USA), Finale
- 5000-Meter-Lauf, Männer: 14:15,4 min – Herbert Schade (BR Deutschland), Vorlauf
- 5000-Meter-Lauf, Männer: 14:06,6 min – Emil Zátopek (Tschechoslowakei), Finale
- 10.000-Meter-Lauf, Männer: 29:17,0 min – Emil Zátopek (Tschechoslowakei)
- Marathonlauf, Männer: 2:23:04 h – Emil Zátopek (Tschechoslowakei)
- 110-Meter-Hürdenlauf, Männer: 13,9 s (egalisiert) – Harrison Dillard (USA), Vorlauf
- 110-Meter-Hürdenlauf, Männer: 13,7 s – Harrison Dillard (USA), Finale
- 110-Meter-Hürdenlauf, Männer: 13,7 s – Jack Davis (USA), Finale
- 400-Meter-Hürdenlauf, Männer: 50,8 s – Charles Moore (USA), Viertelfinale
- 400-Meter-Hürdenlauf, Männer: 50,8 s (egalisiert) – Charles Moore (USA), Finale
- 3000-Meter-Hindernislauf, Männer: 8:58,0 min – Wladimir Kasanzew (Sowjetunion), Vorlauf
- 3000-Meter-Hindernislauf, Männer: 8:51,0 min – Horace Ashenfelter (USA), Vorlauf
- 10.000-Meter-Bahngehen, Männer: 45:02,8 min – John Mikaelsson (Schweden)
- 50-km-Gehen, Männer: 4:28:08 h – Giuseppe Dordoni (Italien), Finale
- Hochsprung, Männer: 2,04 m – Walt Davis (USA), Finale
- Stabhochsprung, Männer: 4,55 m – Bob Richards (USA), Finale
- Kugelstoßen, Männer: 17,41 m – Parry O’Brien (USA), Finale
- Diskuswurf, Männer: 53,47 m – Sim Iness (USA), Finale
- Diskuswurf, Männer: 53,78 m – Adolfo Consolini (Italien), Finale
- Diskuswurf, Männer: 53,60 m – Sim Iness (USA), Finale
- Diskuswurf, Männer: 55,03 m – Sim Iness (USA), Finale
- Hammerwurf, Männer: 57,20 m – József Csermák (Ungarn), Qualifikation
- Hammerwurf, Männer: 58,45 m – József Csermák (Ungarn), Finale
- Speerwurf, Männer: 73,78 m – Cy Young (USA), Finale
- 100-Meter-Lauf, Frauen: 11,9 s (egalisiert) – Catherine Hardy (USA), Vorlauf
- 100-Meter-Lauf, Frauen: 11,6 s – Marjorie Jackson (Australien), Vorlauf
- 100-Meter-Lauf, Frauen: 11,6 s (egalisiert) – Marjorie Jackson (Australien), Viertelfinale
- 200-Meter-Lauf, Frauen: 24,3 s (egalisiert) – Nadeschda Chnykina (Sowjetunion), Vorlauf
- Weitsprung, Frauen: 6,16 m – Yvette Williams (Neuseeland), Qualifikation
- Weitsprung, Frauen: 6,24 m – Yvette Williams (Neuseeland), Finale
- Kugelstoßen, Frauen: 13,88 m – Klawdija Totschonowa (Sowjetunion), Qualifikation
- Kugelstoßen, Frauen: 15,00 m – Galina Sybina (Sowjetunion), Finale
- Diskuswurf, Frauen: 50,84 m – Nina Romaschkowa (Sowjetunion), Finale
- Diskuswurf, Frauen: 51,42 m – Nina Romaschkowa (Sowjetunion), Finale
- Speerwurf, Frauen: 46,17 m – Alexandra Tschudina (Sowjetunion), Qualifikation
- Speerwurf, Frauen: 50,47 m – Dana Zátopková (Tschechoslowakei), Finale
Erfolgreichste Nation waren wie bei allen Spielen in der Leichtathletik zuvor die Vereinigten Staaten mit fünfzehn Goldmedaillen. Mit deutlichem Abstand rangierte die Tschechoslowakei mit vier Olympiasiegen auf dem zweiten Platz knapp vor Australien, das dreimal ganz vorne lag. Je zwei Goldmedaillen errangen die Sowjetunion und Jamaika. Das UdSSR-Team stellte sich bei seiner ersten Teilnahme nach dem Zweiten Weltkrieg als Leichtathletikgroßmacht vor. Neben den zwei Goldmedaillen errang die Mannschaft noch acht Silber- und sieben Bronzemedaillen.
Herausragender Sportler dieser Spiele war der Langstreckenläufer Emil Zátopek aus der Tschechoslowakei. Er wurde zunächst Doppelolympiasieger über 5000 und 10.000 Meter. Am Schlusstag nahm er dann auch noch am Marathonlauf teil und errang trotz seiner Unerfahrenheit auf dieser Distanz seine dritte Goldmedaille. Die Leistung, sämtliche Langstreckenwettbewerbe im selben Jahr bei Olympischen Spielen zu gewinnen, ist bis heute einmalig in der Leichtathletikgeschichte.
Es gab fünf weitere Sportler, die je zwei Goldmedaillen bei diesen Spielen errangen:
- Marjorie Jackson (Australien): 100- und 200-Meter-Lauf. Sie war die Sprintkönigin von Helsinki.
- Lindy Remigino (USA): 100-Meter-Lauf und 4-mal-100-Meter-Staffel
- Andy Stanfield (USA): 200-Meter-Lauf und 4-mal-100-Meter-Staffel
- George Rhoden (Jamaika): 400-Meter-Lauf und 4-mal-400-Meter-Staffel
- Harrison Dillard (USA): 100-Meter-Lauf und 4-mal-100-Meter-Staffel
Folgende hier siegreiche Leichtathleten hatten bereits bei früher ausgetragenen Olympischen Spielen Goldmedaillen errungen:
- Emil Zátopek, (Tschechoslowakei) – 10.000-Meter-Lauf, Wiederholung seines Erfolgs von 1948, hier außerdem siegreich im 5000-Meter- und Marathonlauf, damit jetzt vierfacher Olympiasieger
- Harrison Dillard, (USA) – 110-Meter-Hürdenlauf, 1948 siegreich im 100-Meter-Lauf und mit der 4-mal-100-Meter-Staffel, hier außerdem wieder siegreich mit der 4-mal-100-Meter-Staffel, damit jetzt vierfacher Olympiasieger
- Mal Whitfield, (USA) – 800-Meter-Lauf, zweiter Sieg in Folge, 1948 außerdem siegreich mit der 4-mal-400-Meter-Staffel, damit jetzt dreifacher Olympiasieger
- John Mikaelsson, (Schweden) – 10.000-Meter-Bahngehen, Wiederholung seines Erfolgs von 1948, damit jetzt zweifacher Olympiasieger
- Bob Mathias, (USA) – Zehnkampf, Wiederholung seines Erfolgs von 1948, damit jetzt zweifacher Olympiasieger
- Arthur Wint, (Jamaika) – 4-mal-400-Meter-Staffel, 1948 siegreich im 400-Meter-Lauf, damit jetzt zweifacher Olympiasieger
Remove ads
Resultate Männer
Zusammenfassung
Kontext
100 m
Finale am 21. Juli
Teilnehmer aus dem deutschsprachigen Raum:
 Werner Zandt (Viertelfinale) und Erich Fuchs (Vorläufe)
Werner Zandt (Viertelfinale) und Erich Fuchs (Vorläufe) Hans Wehrli-Frei (Viertelfinale) sowie Fritz Griesser und Willy Schneider (Vorläufe)
Hans Wehrli-Frei (Viertelfinale) sowie Fritz Griesser und Willy Schneider (Vorläufe)
200 m
Finale am 23. Juli
Wind: +1,0 m/s
Teilnehmer aus dem deutschsprachigen Raum:
 Werner Zandt (Halbfinale) und Peter Kraus (Viertelfinale)
Werner Zandt (Halbfinale) und Peter Kraus (Viertelfinale) Fred Hammer und Roby Schaeffer (Vorläufe)
Fred Hammer und Roby Schaeffer (Vorläufe) Willy Eichenberger, Ernst Mühlethaler und Hans Wehrli-Frei (Vorläufe)
Willy Eichenberger, Ernst Mühlethaler und Hans Wehrli-Frei (Vorläufe)
400 m
Finale am 25. Juli
Weitere Teilnehmer aus dem deutschsprachigen Raum:
 Hans Geister (Halbfinale)
Hans Geister (Halbfinale) Jean Hamilius, Fred Hammer und Gérard Rasquin (Vorläufe)
Jean Hamilius, Fred Hammer und Gérard Rasquin (Vorläufe) Rupert Blöch und Rudolf Haidegger (Vorläufe)
Rupert Blöch und Rudolf Haidegger (Vorläufe) Hans Ernst Schneider (Viertelfinale), Josef Steger und Ernst von Gunten (Vorläufe)
Hans Ernst Schneider (Viertelfinale), Josef Steger und Ernst von Gunten (Vorläufe)
800 m
- Mal Whitfield wiederholte seinen Olympiasieg von 1948
Finale am 22. Juli
Weitere Teilnehmer aus deutschsprachigen Nationen:
 Urban Cleve (Halbfinale)
Urban Cleve (Halbfinale) Johannes Baumgartner und Fred Lüthi (Vorläufe)
Johannes Baumgartner und Fred Lüthi (Vorläufe)
1500 m
Finale am 26. Juli
Weitere Teilnehmer aus deutschsprachigen Nationen:
 Günter Dohrow (Halbfinale)
Günter Dohrow (Halbfinale) Fritz Prossinagg (Vorläufe)
Fritz Prossinagg (Vorläufe) Fred Lüthi (Vorläufe)
Fred Lüthi (Vorläufe)
5000 m

Szene aus dem 5000-Meter-Rennen in Helsinki
Finale am 24. Juli
Weitere Teilnehmer aus deutschsprachigen Nationen:
 Paul Frieden (Vorläufe)
Paul Frieden (Vorläufe) Helmuth Perz und Kurt Rötzer (Vorläufe)
Helmuth Perz und Kurt Rötzer (Vorläufe) Pierre Page und August Sutter (Vorläufe)
Pierre Page und August Sutter (Vorläufe)
10.000 m
- Olympiasieger Emil Zátopek errang seine erste von drei Goldmedaillen hier in Helsinki
Datum: 20. Juli
Teilnehmer aus deutschsprachigen Nationen:
 Helmuth Perz (27.)
Helmuth Perz (27.)
Marathon
Datum: 27. Juli
Teilnehmer aus deutschsprachigen Nationen:
 Dieter Engelhardt (30.) und Ludwig Warnemünde (43.)
Dieter Engelhardt (30.) und Ludwig Warnemünde (43.) Adolf Gruber (39.)
Adolf Gruber (39.) Rudolf Morgenthaler (50.)
Rudolf Morgenthaler (50.)
110 m Hürden

Harrison Dillard holte sich hier das vier Jahre zuvor verpasste Olympiagold im Hürdensprint
Finale am 24. Juli, 18:20 Uhr
Teilnehmer aus deutschsprachigen Nationen:
 Wolfgang Troßbach (Vorläufe)
Wolfgang Troßbach (Vorläufe) Jean Fonck (Vorläufe)
Jean Fonck (Vorläufe) Oliver Bernard (Vorläufe)
Oliver Bernard (Vorläufe)
400 m Hürden
Finale am 21. Juli, 17:40 Uhr
Teilnehmer aus deutschsprachigen Nationen:
3000 m Hindernis

Überraschungssieger Horace Ashenfelter
Finale am 25. Juli, 16:20 Uhr
Keine weiteren Teilnehmer aus dem deutschsprachigen Raum
4 × 100 m Staffel
Finale am 27. Juli, 17:10 Uhr
Teilnehmer aus deutschsprachigen Nationen:
 BR Deutschland – Peter Kraus, Werner Zandt, Josef Heinen, Franz Happernagl (VL)
BR Deutschland – Peter Kraus, Werner Zandt, Josef Heinen, Franz Happernagl (VL) Schweiz – Willy Schneider, Willy Eichenberger, Ernst Mühlethaler, Hans Wehrli-Frei (VL)
Schweiz – Willy Schneider, Willy Eichenberger, Ernst Mühlethaler, Hans Wehrli-Frei (VL)
4 × 400 m Staffel
Finale am 27. Juli, 17:20 Uhr
Weitere Teilnehmer aus deutschsprachigen Nationen:
 Luxemburg – Roby Schaeffer, Jean Hamilius, Fred Hammer, Gérard Raquin (VL)
Luxemburg – Roby Schaeffer, Jean Hamilius, Fred Hammer, Gérard Raquin (VL) Schweiz – Hans Ernst Schneider, Josef Steger, Paul Stalder, Ernst von Gunten (VL)
Schweiz – Hans Ernst Schneider, Josef Steger, Paul Stalder, Ernst von Gunten (VL)
10.000 m Gehen

John Mikaelsson gewann wie schon 1948 Gold
Finale am 27. Juli
Keine weiteren Teilnehmer aus dem deutschsprachigen Raum
50 km Gehen
Datum: 21. Juli
Teilnehmer aus dem deutschsprachigen Raum:
 Rudi Lüttge (13.)
Rudi Lüttge (13.) Gilert Marquis (24.) und René Charrière (26.)
Gilert Marquis (24.) und René Charrière (26.)
Hochsprung
Finale am 20. Juli
Teilnehmer aus dem deutschsprachigen Raum:
 Hans Wahli (16.)
Hans Wahli (16.)
Stabhochsprung
Finale am 22. Juli
Teilnehmer aus dem deutschsprachigen Raum:
Weitsprung
Finale am 21. Juli
Teilnehmer aus dem deutschsprachigen Raum:
 Felix Würth (15.)
Felix Würth (15.) Toni Breder (19.)
Toni Breder (19.)
Dreisprung
- Adhemar da Silva – Olympiasieger mit zwei Weltrekorden
Finale am 23. Juli
Teilnehmer aus dem deutschsprachigen Raum:
 Felix Würth (31.)
Felix Würth (31.) Willi Burgard (29.)
Willi Burgard (29.)
Kugelstoßen
Finale am 21. Juli
Teilnehmer aus dem deutschsprachigen Raum:
 Alois Schwabl (13.)
Alois Schwabl (13.)
Diskuswurf
Finale am 22. Juli
Teilnehmer aus dem deutschsprachigen Raum:
 Josef Hipp (27.)
Josef Hipp (27.) Oskar Häfliger (23.)
Oskar Häfliger (23.)
Hammerwurf
Finale am 24. Juli
Weiterer Teilnehmer aus dem deutschsprachigen Raum:
Speerwurf
Finale am 23. Juli
Teilnehmer aus dem deutschsprachigen Raum:
 Herbert Koschel (12.)
Herbert Koschel (12.)
Zehnkampf
- Olympiasieger Bob Mathias auf einer Briefmarke des Emirats Adschman aus dem Jahr 1971
Datum: 25./26. Juli
Weiterer Teilnehmer aus dem deutschsprachigen Raum:
 Max Wehrli (18.)
Max Wehrli (18.)
Remove ads
Resultate Frauen
Zusammenfassung
Kontext
100 m

Olympiasiegerin Marjorie Jackson
Finale am 22. Juli
Weitere Teilnehmerinnen aus dem deutschsprachigen Raum:
 Marga Petersen (HF) und Helga Klein (HF)
Marga Petersen (HF) und Helga Klein (HF) Elfriede Steurer (VL)
Elfriede Steurer (VL) Sonja Prétôt (VL)
Sonja Prétôt (VL)
200 m

Die Medaillengewinnerinnen (v. l. n. r.): Nadeschda Chnykina, Marjorie Jackson, Bertha Brower
Finale am 26. Juli
Weitere Teilnehmerin aus dem deutschsprachigen Raum:
 Ursula Knab (HF)
Ursula Knab (HF)
80 m Hürden
- Nach dreimal Bronze (OS1948: 100 m / 80 m Hürden, hier in Helsinki: 80 m Hürden) sowie einmal Silber (OS 1948: 4 × 100 m) gab es nun Gold für Shirley Strickland
Finale am 24. Juli
Weitere Teilnehmerinnen aus dem deutschsprachigen Raum:
 Helene Bielansky (VL)
Helene Bielansky (VL) Elfriede Steurer (VL)
Elfriede Steurer (VL) Hilde Antes (VL)
Hilde Antes (VL) Gretel Bolliger (VL)
Gretel Bolliger (VL)
4 × 100 m Staffel
Finale am 27. Juli
Weitere Teilnehmerinnen aus dem deutschsprachigen Raum:
a
Die unstimmige Diskrepanz zwischen hangestoppter und elektronisch gemessener Zeit lässt sich am ehesten erklären durch einen unkorrekten Wert der Handzeit, richtig wären hier wohl 47,0 s.[4]
Hochsprung
Finale am 27. Juli
Keine weiteren Teilnehmerinnen aus dem deutschsprachigen Raum.
Weitsprung

Olympiasiegerin Yvette Williams
Finale am 23. Juli
Weitere Teilnehmerinnen aus dem deutschsprachigen Raum:
 Elfriede von Nitzsch (14.) und Leni Hofknecht (15.)
Elfriede von Nitzsch (14.) und Leni Hofknecht (15.) Ursula Finger (25.)
Ursula Finger (25.) Gretel Bolliger (30.)
Gretel Bolliger (30.)
Kugelstoßen

Kugelstoß-Siegerehrung (v. l. n. r.): Klawdija Totschonowa, Galina Sybina, Marianne Werner
Finale am 26. Juli
Weitere Teilnehmerinnen aus dem deutschsprachigen Raum:
 Dorothea Kreß (11.)
Dorothea Kreß (11.) Gretel Bolliger (17.)
Gretel Bolliger (17.)
Diskuswurf
Finale am 20. Juli
Weitere Teilnehmerinnen aus dem deutschsprachigen Raum:
 Marianne Werner (9.)
Marianne Werner (9.) Frieda Tiltsch (18.)
Frieda Tiltsch (18.) Gretel Bolliger (17.)
Gretel Bolliger (17.)
Speerwurf

Olympiasiegerin Dana Zátopková (hier im Jahr 2007)
Finale am 24. Juli
Weitere Teilnehmerinnen aus dem deutschsprachigen Raum:
 Ingeborg Bausenwein (12.)
Ingeborg Bausenwein (12.) Herma Bauma (9.) und Gerda Staniek (DNF)
Herma Bauma (9.) und Gerda Staniek (DNF)
Remove ads
Literatur
- Ekkehard zur Megede: Die Geschichte der olympischen Leichtathletik. Band 2: 1948–1968. Verlag Bartels & Wernitz KG, Berlin, 2. Auflage 1970.
Weblinks
- XV Olympic Game, Helsinki 1952 auf trackfield.brinkster.net, abgerufen am 11. August 2021
- Seite des IOC zur Leichtathletik bei den Olympischen Spielen 1952 (englisch) auf olympic.org, abgerufen am 11. August 2021
- Official Report of the Organising Committee for the Games of the XV Olympiad, Helsinki, 1952 (englisch) auf library.la84.org (PDF; 39.437 KB), abgerufen am 11. August 2021
- Helsinki 1952: Zatopek mit historischem Triple auf sportschau.de, abgerufen am 24. September 2017
- So hatte sich Coubertin Olympische Spiele vorgestellt. In: Neue Zürcher Zeitung 19. Juli 2002, auf nzz.ch, abgerufen am 24. September 2017
- In Finnland liegt die Seele der Leichtathletik, Frankfurter Allgemeine Zeitung 5. August 2005, auf faz.net, abgerufen am 24. September 2017
- Olympia 1952. Absage für ein Flüchtlingsteam, Spiegel Online 6. August 2016, auf spiegel.de, abgerufen am 24. September 2017
- OLYMPIA, Der Spiegel 40/55, Spiegel Online 28. September 1955, auf spiegel.de, abgerufen am 24. September 2017
- EMIL ZATOPEK. Sport ist Schwerarbeit, Der Spiegel 29/52, Spiegel Online 16. Juli 1952, auf spiegel.de, abgerufen am 24. September 2017
- NERVENKRISE. Es grassieren Gerüchte, Der Spiegel 31/52, Spiegel Online 30. Juli 1952, auf spiegel.de, abgerufen am 24. September 2017
- RÄTSEL. Die Tschudina kam, Der Spiegel 30/52, Spiegel Online 23. Juli 1952, auf spiegel.de, abgerufen am 24. September 2017
- Vom Ausschluss zur Integration? Frauen und Olympische Spiele, DOSB 21. Mai 2002 auf dosb.de, abgerufen am 24. September 2017
- Die familiären Spiele von 1952 und das erboste IOC, Deutschlandfunk 21. Juli 2012 auf deutschlandfunk.de, abgerufen am 24. September 2017
- Leichtathletik-WM 2017 auf sportschau.de, abgerufen am 24. September 2017
Remove ads
Videolinks
- 1952 Summer Olympic Games in Helsinki, Finland – CharlieDeanArchives / Archival Footage, youtube.com, abgerufen am 24. September 2017
- Emil Zatopek Olympische Spiele Helsinki 1952 mpg 360p, youtube.com, abgerufen am 24. September 2017
- Helsingin Olympialaiset 1952 väreissä, osa 1, youtube.com, abgerufen am 24. September 2017
- Helsingin Olympialaiset 1952 väreissä, osa 2, youtube.com, abgerufen am 24. September 2017
Einzelnachweise
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads