Top-Fragen
Zeitleiste
Chat
Kontext
Spätmittelalter
historischer Zeitraum der europäischen Geschichte Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Remove ads
Als Spätmittelalter wird der Zeitraum der europäischen Geschichte von der Mitte des 13. bis zum Ende des 15. oder Anfang des 16. Jahrhunderts bezeichnet (also ca. 1250 bis 1500). Sie stellt die Endphase des Mittelalters dar, auf welche die Frühe Neuzeit folgt. Eine generelle zeitliche Eingrenzung des Übergangs vom Spätmittelalter in die Renaissance ist nicht möglich, da letztere wesentlich aus der kulturphilosophischen und kunstgeschichtlichen Entwicklung heraus definiert ist und sich in den europäischen Regionen unterschiedlich schnell ausbreitete. So entstand kulturgeschichtlich betrachtet der Renaissance-Humanismus bereits im 14. Jahrhundert und wird politisch noch zum Spätmittelalter gezählt. Reformation und das Zeitalter der europäischen überseeischen Expansion markieren das endgültige Ende der Epoche.

Im europäischen Kontext ist das Spätmittelalter geprägt von Wandel und Umbruch auf einem Fundament älterer Traditionen. Im römisch-deutschen Reich etablierte sich endgültig die kurfürstliche Wahlmonarchie (seit 1356 mit der Goldenen Bulle als „Grundgesetz“), in der das vergleichsweise schwache Königtum auf den Konsens mit den Großen angewiesen war und die Hausmachtpolitik eine zentrale Rolle spielte. In diesem Zusammenhang ergaben sich auch Spielräume königlicher Politik. Während im 14. und frühen 15. Jahrhundert die Häuser Habsburg, Luxemburg und Wittelsbach um die Krone konkurrierten, stellten die Habsburger ab 1438 alle folgenden römisch-deutschen Könige. Ein Kerngedanke im 15. Jahrhundert war die Reichsreform, die aber nur ansatzweise umgesetzt wurde. Der dennoch feststellbare Struktur- und Verfassungswandel in dieser Zeit wird in der neueren Forschung als „Verdichtung“ des Reiches bezeichnet, wenngleich die Institutionalisierung auf der Reichsebene insgesamt eher unzureichend blieb.
Zwischen England und Frankreich brach unter anderem aufgrund von Thronstreitigkeiten 1337 der sogenannte Hundertjährige Krieg aus, der sehr wechselhaft verlief. Der Krieg endete 1453 siegreich für Frankreich, hatte aber beide Länder ausgeblutet. Frankreich büßte zudem seine im 13. Jahrhundert errungene europäische Machtstellung stark ein und wurde im Inneren vom Machtkampf zwischen dem regierenden Haus Valois und dem Haus Burgund geplagt. Diese Auseinandersetzung gewann eine europäische Komponente, als weite Teile Burgunds Ende des 15. Jahrhunderts zeitweise an die Habsburger fielen und sich der folgende französisch-habsburgische Konflikt bis weit ins 16. Jahrhundert fortsetzte. Währenddessen erlebte England eine innenpolitische Krise und mehrere Thronkämpfe, die schließlich in den blutigen Rosenkriegen gipfelten.

In Südeuropa spielte das Königreich Aragón im Mittelmeerraum eine wichtige Rolle, während die Reconquista sich in ihrer Endphase befand und 1492 abgeschlossen wurde. Aragón und Kastilien schlossen sich zudem zu einer Union zusammen, es entstand das Königreich Spanien, mit dem in der folgenden Zeit Portugal konkurrierte. Italien war geteilt in das zum römisch-deutschen Reich gehörende Reichsitalien, den Kirchenstaat, die Republik Venedig und das Königreich Neapel(-Sizilien), wobei die verschiedenen reichsitalienischen Stadtstaaten eine weitgehend unabhängige Politik betrieben. Die alte kaiserliche Italienpolitik, die auf die Wahrung und Einforderung formaler Rechte pochte, war mit dem Tod Kaiser Heinrichs VII. 1313 faktisch beendet. Die folgenden Italienzüge der römisch-deutschen Könige hatten nur noch die Kaiserkrönung und/oder die Nutzung der erheblichen Finanzkraft der Kommunen zum Ziel. Aber auch die Gestaltungskraft der zweiten mittelalterlichen Universalmacht, des Papsttums, hatte erheblich eingebüßt. Die Päpste residierten seit 1309 in Avignon, das sogenannte avignonesische Papsttum stand unter weitgehender Kontrolle des französischen Königshofes. Eine Doppelwahl 1378 führte zum Abendländischen Schisma, das die lateinische Christenheit bis 1417 tief spaltete. Auch andere innerkirchliche Probleme sorgten dafür, dass der Ruf nach einer Kirchenreform immer lauter wurde und schließlich zur Reformation führte.
In Nordeuropa war das Königreich Dänemark die dominierende Macht, nachdem es 1397 unter dessen Führung zur Kalmarer Union mit Schweden und Norwegen kam. Im Ostseeraum traten konkurrierend die wirtschaftlich mächtige Hanse und im Baltikum der Deutsche Orden auf. Letzterer führte mehrere Kriege mit dem Großfürstentum Litauen, bevor dieses 1386 mit Polen die Polnisch-Litauische Union bildete und sich als neue Großmacht behaupten konnte. Im späten 14. Jahrhundert befreite sich das Großfürstentum Moskau von der Herrschaft der mongolischen Goldenen Horde und expandierte in der Folgezeit beträchtlich. Auf dem Balkan waren das Königreich Ungarn und das Königreich Serbien bedeutende Reiche. Beide standen aber seit dem späten 14. Jahrhundert unter starken Druck durch das nach Südosteuropa expandierende Osmanische Reich. Dieses eroberte 1453 nicht nur Konstantinopel und beendete damit die lange Geschichte des Byzantinischen Reiches, auch Serbien und Bulgarien gerieten im 15. Jahrhundert endgültig und für lange Zeit unter osmanische Herrschaft, während die Ungarn die Türken vorerst mit Mühe abwehren konnten.
Ganz Europa wurde Mitte des 14. Jahrhunderts von der großen Pest getroffen, dem sogenannten „Schwarzen Tod“. Ausgehend von Zentralasien gelangte die bislang größte Pandemie der Menschheitsgeschichte Ende 1347 in den Mittelmeerraum und breitete sich im folgenden Jahr in Europa aus. Sie forderte Millionen von Todesopfern und hatte weitreichende sozioökonomische Folgen.
Das Spätmittelalter wurde in der älteren Forschung wegen bestimmter Erscheinungen wie Agrarproblemen (die aber differenziert betrachtet werden müssen) und politischen Veränderungen im römisch-deutschen Reich in der deutschen Mediävistik oft als Krisenzeit betrachtet, als eine „Verfallszeit“. In Italien und Frankreich wurde keine derartig scharfe Trennung vorgenommen. In der neueren deutschsprachigen Forschung wird jedoch ebenfalls wesentlich differenzierter geurteilt, vor allem durch neue Forschungsansätze und Quellenbefunde: Bei allen auftretenden Problemen war das Spätmittelalter geprägt von einer gestiegenen Mobilität und Internationalität, Veränderungen in vielen Lebensbereichen (wie Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur) und schließlich dem Übergang in die Frühmoderne. Insofern hat ein deutlicher Paradigmenwechsel in der deutschen Spätmittelalterforschung stattgefunden.
Unbestritten sind Krisenerscheinungen wie Seuchen und ein Bevölkerungsrückgang im 14. Jahrhundert, die aber nicht verallgemeinert werden können, zumal das Spätmittelalter von dynamischen Entwicklungen geprägt war. So schritt im römisch-deutschen Reich der institutionalisierte Ausbau der fürstlichen Territorien voran, wobei die weltlichen und geistlichen Landesherren sich im Kräftespiel mit dem Königtum behaupten konnten. Ebenso nahm die Bedeutung der Städte beträchtlich zu, die wichtige Wirtschafts- und Bildungszentren darstellten und deren Bevölkerung insgesamt wuchs. Gesellschaftlich wurde so auch das Bürgertum immer bedeutender und die soziale Mobilität nahm zu. Die Städte institutionalisierten sich politisch (so durch Stadträte und Städtebünde) und wirtschaftlich zunehmend, wobei sie ihre Rechte vehement verteidigten, was teilweise zu Konflikten mit den umliegenden Landesherren führte. Im Spätmittelalter entfalteten sich weitgespannte Handelsnetzwerke, wie das der Hanse und italienischer Handelsgesellschaften, die in den östlichen Mittelmeerraum und weit nach Norden reichten. In diesem Zusammenhang stieg die Bedeutung des komplexer werdenden Bankensystems und der Geldwirtschaft. Die kulturelle Neubelebung im Rahmen der Renaissance setzte wichtige Impulse in Kunst, Philosophie, Literatur und Architektur. Die Erfindung des Buchdrucks stellte eine kommunikative Revolution dar, wodurch wiederentdeckte antike Klassiker und neue Abhandlungen wesentlich leichter und schneller verbreitet werden konnten. Neue Ideen entstanden und wurden intensiv ausgetauscht, einschließlich eines stärker individualisierten Menschenbilds. Dies führte unter anderem zu einer verstärkten Kirchenkritik, abweichenden christlichen Bewegungen und mündete in der Reformation, wozu kirchliche Missstände und das Schisma beitrugen. Die Bedeutung der Universitäten nahm weiter zu, wobei die Bildung nun längst nicht mehr primär auf die Geistlichkeit beschränkt war und im Spätmittelalter erstmals Universitäten im deutschen Reichsteil gegründet wurden. Gelehrtes Personal spielte außerdem in der nun viel stärker durch Schriftlichkeit geprägten Verwaltung im Reich, in den Städten und in den Territorien eine wichtige Rolle.
Remove ads
Begriffs- und Forschungsproblematik
Zusammenfassung
Kontext
Jede Periodisierung ist zu einem gewissen Grad willkürlich und hängt vor allem von den Forschungsperspektiven ab, welche Aspekte man primär betrachtet und wie man sie gewichtet. Der Begriff Spätmittelalter ist relativ jung, etablierte sich erst im frühen 20. Jahrhundert in der historischen Forschung und war von Beginn an nicht unproblematisch, da mit spät auch Absterben und Verfall assoziiert wurde.[1] Dies kam nicht zuletzt in der 1919 erschienenen Darstellung Herbst des Mittelalters von Johan Huizinga zum Ausdruck: Eine Zeit des Umbruchs, aber auch des Niedergangs, verbunden mit einer „auf das Spätmittelalter projizierten europäischen Untergangsstimmung“.[2] In der nationalstaatlich geprägten älteren deutschen Forschung war aber bereits vor dem Aufkommen des Begriffs „Spätmittelalter“ die Zeit nach dem Untergang der Staufer 1250 als eine Verfallszeit im römisch-deutschen Reich begriffen worden (ein „Restmittelalter“), in der eine neue, eine schlechtere Zeit begonnen habe, die erst mit der Reformation endete.[3] Die Dreiteilung des Mittelalters entsprach in diesem Sinne sehr einer deutschen Perspektive, die in dynastischen Abfolgen dachte sowie mit einem Beginn, einem Höhepunkt und einem Niedergang argumentierte; weit weniger assoziativ verfuhr die italienische, französische und spanische Forschung.[4] Ernst Schubert schrieb dazu: „Spätmittelalter als Epochenbegriff war von der Negation her entwickelt worden.“[5]

Diese Einstellung reflektiert jedoch keineswegs mehr die aktuelle Forschung. 1990 hatte sich Erich Meuthen intensiv mit der Entstehung und der Sinnhaftigkeit des Begriffs Spätmittelalter auseinandergesetzt und die Krisenerzählung infrage gestellt: „Die dann folgende "Krise des Mittelalters" als Wirtschaftskrise hat sich jedoch als durchaus nicht so epochal herausgestellt, wie man vorübergehend meinte. [...] Andererseits scheint das "späte" Mittelalter dieser großeuropäischen Geschichte nach der sich immer mehr verdichtenden Ansicht der Forschung doch auch und gerade so in höchst förderlichem Maße gedient zu haben. Wichtige Fundamente der neuen staatlichen Ordnung auch in Deutschland sind demnach in eben jenem ausgehenden Mittelalter gelegt worden.“[6] In der Mediävistik bildet das Spätmittelalter inzwischen den Schwerpunkt der Forschung.[7] Neue Quellen, methodische Ansätze, Fragestellungen und Erkenntnisse haben zu einer vollkommenen Neubewertung des Spätmittelalters geführt, wobei verstärkt eine europäische Perspektive berücksichtigt und der Charakter der Umbruchszeit (zwischen Tradition und Wandel) betont wird. Der Beginn der Epoche, wenngleich in der Forschung diskutiert, wird zwar in der Regel auf die Zeit um 1250 angesetzt, wobei nun jedoch vor allem „Qualitätswandlungen“ (so im politischen System, im gesellschaftlichen, technischen und kulturellen Bereich) als Kennzeichen der neuen Zeit betrachtet werden.[8]
Unbestritten sind Krisenphänomene, so Hungersnöte und Seuchen wie die Hungersnot von 1315–1317 und der Schwarze Tod 1347–1353. Soziale Erhebungen und Bürgerkriege führten in Frankreich und England zu schweren Volksaufständen (Jacquerie und der Bauernaufstand von 1381 in England), und zwischen diesen beiden Staaten brach der Hundertjährige Krieg aus. Die Einheit der lateinischen Kirche wurde durch das Große Schisma erschüttert. Papsttum und Kaisertum mussten Autorität einbüßen. Die Gesamtheit dieser Ereignisse wurde oft Krise des Spätmittelalters genannt. Ein zentraler Punkt ist die sogenannte spätmittelalterliche Wirtschaftskrise, die eine Absatzkrise darstellte, die allerdings in der neueren Forschung im Rahmen eines Strukturwandels differenzierter betrachtet wird.[9] Die spätmittelalterliche Wirtschaftsgeschichte ist des Weiteren vor allem von expandierenden Handelsnetzwerken wie der Hanse, italienischen Handelsgesellschaften und einer Zunahme des immer komplexer werdenden Bankwesens und des Geldhandels geprägt.[10] Hierbei gewannen die Städte als Umschlagplätze und Handelszentren noch stärker an Bedeutung. Die spätmittelalterliche Stadtgeschichte ist des Weiteren geprägt von stärker werdenden politischen Organisationsformen (Stadtrat und Stadtrecht) und teils daraus resultierenden inneren Konflikten (wie zwischen Zünften und Patriziern).[11] Die spätmittelalterliche Agrarkrise wiederum ist methodisch durchaus umstritten. Allerdings kam es Mitte des 14. Jahrhunderts offenbar zu einem erheblichen Bevölkerungseinbruch, der aber auch verbunden mit strukturellen Problemen und klimatisch begründeten Missernten war.[12] Hinzu kamen Seuchen und andere Umweltfaktoren, doch auch hier warnt die Quellen- und Forschungslage vor Pauschalurteilen.[13]
Insgesamt bleiben viele Fragen uneindeutig oder offen. Krisenphänomene lassen sich jedenfalls aufgrund der Quellenlage nicht thematisch, geographisch und zeitlich verallgemeinern. Es gab im Verlauf des Spätmittelalters starke Unterschiede und immer wieder prosperierende und krisengeprägte Regionen und Zeiträume, wobei die Gründe im Einzelfall stark variieren können. Es ist zudem wichtig zu erklären, was unter Krise zu verstehen ist, denn die moderne Krisentheorie kennt diverse Modelle. Daraus folgt, dass die Kriterien methodisch sauber und nachvollziehbar definiert werden müssen, so dass nicht jedes passend erscheinende Phänomen gleich als „Krise“ bezeichnet werden kann; des Weiteren ist zwischen mehr oder weniger allgemeinen Krisen und Teilkrisen zu differenzieren.[14] In diesem Sinne ergeben sich zudem wichtige Differenzierungen zu Regionen und Zeitabschnitten, so dass Pauschalurteile abzulehnen sind: Bei durchaus feststellbaren Krisenphänomenen des 14. Jahrhunderts sind deshalb stets einzelne Komponenten zu unterscheiden (wie beispielsweise klimatische, biologische, ökonomische und soziale Teile sowie politische Rahmenbedingungen).[15]

Das Spätmittelalter war zudem eine Zeit des künstlerischen und wissenschaftlichen Fortschritts. Die „Wiederentdeckung“ antiker Texte und vor allem deren systematische Sammlung führten zur Renaissance, der „Wiedergeburt“ des antiken Geisteslebens (siehe auch Renaissance-Humanismus). Diese Entwicklung wurde durch die Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen 1453 beschleunigt. Viele byzantinische Gelehrte flohen in den Westen, insbesondere nach Italien, ebenso gelangten von dort im Westen bislang verlorene Werke in das lateinische Europa. Die Erfindung des Buchdrucks Mitte des 15. Jahrhunderts erleichterte die Verbreitung des Geschriebenen und das Lernen als wichtige Voraussetzung für die spätere Kirchenreformation. Die Suche nach einem Seeweg nach Indien hatte die Entdeckung Amerikas 1492 zur Folge und leitete die Europäische Expansion ein.[16] Das lateinische Europa expandierte aber am Ausgang des Spätmittelalters nicht nur in Übersee, sondern auch sozial, wirtschaftlich und gesellschaftlich fand eine Expansion statt.[17] In Europa entwickelten Kaufleute neue Geschäftsmodelle und erweiterten ihre Handelsnetzwerke mit neuen Kommunikationsstrukturen. Neben dem vorherigen dominierenden Luxushandel (siehe Indienhandel) kam nun verstärkt der Handel mit Massenwaren hinzu. Die Geldwirtschaft spielte eine noch größere Rolle als zuvor und die Urbanisierung nahm zu. Es boten sich nun auch mehr Möglichkeiten eines gesellschaftlichen Aufstiegs. Die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des Spätmittelalters ist dementsprechend differenziert zu betrachten.[18] Hinzu kam eine staatlich-organisatorische Integration, die einen Kontrapunkt zur Krisenerzählung darstellt.[19] Im christlich-religiösen Bereich kündigte sich im Spätmittelalter bereits der säkulare Umbruch an, mit einem verstärkten Widerspruch zur offiziellen Lehre des Papstes, was ganz entscheidend das öffentliche und private Leben betraf und schließlich zur Reformation führen sollte.[20]
Remove ads
Das europäische Spätmittelalter: Staaten und Regionen
Zusammenfassung
Kontext
Heiliges Römisches Reich
Vom Interregnum bis zum Tod Ludwigs des Bayern

Nach dem Tod des Stauferkaisers Friedrich II. am 13. Dezember 1250 begann im Heiligen Römischen Reich das Interregnum.[21] Es handelte sich um eine Zeit der Instabilität mit mehreren Königen und Gegenkönigen, in der vor allem die Macht des sich endgültig formierenden Kurfürstenkollegiums (das nun über das exklusive Königswahlrecht verfügte) und die Macht der Landesherren gestärkt wurde. Die staufische Königsherrschaft brach im deutschen Reichsteil bereits vor dem Tod Konrads IV. (1254 in Süditalien) zusammen.[22]
Die ohnehin nie absolute Herrschaftsgewalt des römisch-deutschen Königtums erodierte im Interregnum, als Könige wie Wilhelm von Holland und Richard von Cornwall Güter verschenkten oder verpfändeten, um dadurch die Gunst der Fürsten und Städte zu gewinnen, während andere Rechte usurpiert wurden. In finanzieller und verwaltungstechnischer Hinsicht konnte die Königsgewalt im römisch-deutschen Reich nicht mit den großen westeuropäischen Monarchien Frankreich und England konkurrieren, zumal es keine feste Reichsresidenz gab und bis ins 15. Jahrhundert hinein kein kontinuierlich geführtes zentrales Königsarchiv (siehe unten). Der Machtverlust des Königtums während des Interregnums wird in der neueren Forschung allerdings nicht mehr mit einem völligen Zerfall der politischen Ordnung gleichgesetzt oder dessen Stärke als alleiniger Maßstab für die Zustände in dieser Zeit herangezogen. Das Reich selbst ging trotz aller Probleme nicht unter, aber seine Integrationskraft wurde geringer.[23] Dies bedeutet keineswegs, vorhandene Strukturprobleme zu bestreiten, die sich teils noch verschärfen sollten. So herrschte während des Interregnums kein Mangel an gewählten Königen, vielmehr gab es zeitgleich zu viele Herrscher, die sich zudem nie vollständig durchsetzen konnten. Für diesen Zeitraum ist daher zumindest für die Institution des Königtums eine Krise festzustellen. Die Friedens- und Rechtswahrung war im Mittelalter ein zentraler königlicher Aufgabenbereich. Diese Funktion konnte durch das Königtum während des Interregnums nicht mehr gewährleistet werden,[24] so dass sich königliche Städte in Bündnissen zusammenschlossen, wie vor allem das Beispiel des 1254 gegründeten Rheinischen Städtebunds zeigt, wenngleich dieser bereits 1257 wieder zerfiel.[25] In den diversen Regionen wurde so versucht, ohne die weitgehend ausgefallene Reichsebene zu agieren. Hinzu kam die Einmischung ausländischer Mächte in die Reichspolitik,[26] wobei nicht zuletzt Frankreich vom Ausfall des römisch-deutschen Königtums profitierte und in der Folgezeit Reichsrechte im Grenzraum für sich beanspruchte.

Das Interregnum endete 1273 mit der Wahl Rudolfs von Habsburg zum König, der bereits 55 Jahre alt war.[27] Rudolfs ursprüngliche Machtbasis im Südwesten des deutschen Reichsteils war eher bescheiden, doch es gelang ihm, diese auszubauen und die Königsherrschaft im Vergleich zu den Jahrzehnten zuvor wieder zu stabilisieren. Dies geschah nicht ohne Widerstände, zumal Rudolf sich gegen den König von Böhmen, Přemysl Ottokar II., durchsetzen musste, der Rudolfs Königtum nicht anerkannte und die Lehnshuldigung für Österreich und die Steiermark verweigerte. Rudolf schlug Ottokar in der Schlacht auf dem Marchfeld am 26. August 1278 und erwarb schließlich Österreich, die Steiermark und die Krain, womit er die Grundlage für den Aufstieg des Hauses Habsburg zur mächtigsten Dynastie im Reich legte. Rudolf beachtete aber durchaus die Interessen der Kurfürsten und bewies, dass trotz der veränderten und schwierigen Rahmenbedingungen eine relativ effektive, wenngleich territorial begrenzte Herrschaftsausübung immer noch möglich war, solange ein Konsens mit den Großen bestand (in erster Linie den Kurfürsten sowie anderen mächtigen geistlichen und weltlichen Landesherrn) und diese den König als Wahrer des Friedens und als oberste Herrschaftsinstanz im Reich akzeptierten. Die konsensuale Herrschaftspraxis spielte im spätmittelalterlichen Reich eine wichtige Rolle. Rudolf band wiederholt andere Fürsten in seine Politik einer erneuerten Königsherrschaft ein.[28] Rudolf knüpfte dabei durchaus an staufische Traditionen an, indem er eine gezielte Landfriedenspolitik im Reich betrieb und sich bemühte, entfremdetes Reichsgut zurückzuerlangen (Revindikationspolitik),[29] wobei er die Großen auch hier durch Beratungen auf Hoftagen einband. Er etablierte in diesem Zusammenhang die Landvogteien, um eine effektivere Herrschaftsausübung zu gewährleisten. Die Sicherstellung von Recht und Frieden im Reich gelang ihm weitgehend, was ein bleibendes Verdienst seiner Herrschaft darstellt, besonders angesichts der schwierigen Ausgangsbasis; die Kaiserkrönung, obwohl von ihm ernsthaft angestrebt, erreichte er jedoch nicht. Im Westen bemühte er sich, die voranschreitende Expansion Frankreichs im westlichen Grenzraum und speziell im zum Imperium gehörenden Königreich Burgund zu bremsen.[30]
Nach Rudolfs Tod 1291 bestieg zunächst kein Habsburger den Thron. Wie im späten 13. und im 14. Jahrhundert üblich, legten die Kurfürsten zur Wahrung ihres Einflusses keinen Wert auf eine Erbnachfolge. Sie wählten nun den mit sehr bescheidenen Machtmitteln ausgestatteten Grafen Adolf von Nassau zum König (1292–1298).[31] Seine Regierungszeit war geprägt von einer fast permanenten Geldnot. Entscheidend war jedoch seine Auseinandersetzung mit mehreren Großen, nachdem er bei seiner Königswahl den Kurfürsten große Zugeständnisse gemacht hatte. Dieser Konflikt hatte sich nicht zuletzt an Adolfs Territorialpolitik entzündet, vor allem in Hinblick auf Thüringen, wo Adolf 1294/95 militärisch eingriff, da er diese Region seiner eignen Hausmacht hinzufügen wollte. Des Weiteren zeigte sich der König unfähig, den Forderungen zur Eindämmung der französischen Expansion im Westen nachzukommen, wobei die Habsburger Adolf ohnehin feindlich gegenüberstanden. Es bildete sich eine „Kurfürstenfronde“ gegen Adolf, was schließlich zu seiner formellen Absetzung im Juni 1298 führte. Der König fiel am 2. Juli 1298 in der Schlacht von Göllheim im Kampf gegen Albrecht von Habsburg, den ältesten Sohn Rudolfs, der zuvor als neuer König von den Kurfürsten gewählt worden war. In der neueren Forschung wird eher betont, dass der Schlachtentod des Königs einschneidend wirkte, die Absetzung an sich aber (noch) nicht wirkungsmächtig war.[32]
Albrecht I. (1298–1308)[33] musste mehreren Kurfürsten Konzessionen machen, da diese eine Machtkonzentration der Habsburger verhindern wollten. Das Verhältnis zu den vier rheinischen Kurfürsten war während seiner gesamter Regierungszeit angespannt, da Albrecht eine rigorose Hausmachtpolitik betrieb. In Mitteldeutschland knüpfte er an die Territorialpolitik Adolfs von Nassau an und wurde außerdem im Niederrheingebiet aktiv, wo er die Grafschaften Holland und Seeland beanspruchte. Wiederholt vertrat er die Eigeninteressen seines Hauses und berücksichtigte nicht den herrschaftlichen Konsens mit den anderen Großen, was sich als schwerwiegende Belastung erwies. Albrecht war zunächst von Papst Bonifatius VIII. nicht anerkannt, doch kam es schließlich aufgrund des Konflikts des Papstes mit dem mächtigen französischen König Philipp IV. zu einer Verständigung, wobei Albrecht dem Papst aber einen Treue- und Gehorsamseid leisten musste. Andererseits hatte sich Albrecht zunächst um gute Beziehungen zu Philipp IV. bemüht. Albrecht hatte sich gegenüber dem Kapetinger beim Treffen in Quatrevaux (am 8. Dezember 1299) in Grenzfragen entgegenkommend verhalten und ein bereits zuvor verhandeltes Eheprojekt erneut angesprochen. All dies geschah möglicherweise, um französische Unterstützung für den Plan zu erhalten, im Reich eine Erbmonarchie zu errichten; zumindest waren mehrere Kurfürsten sehr unzufrieden.[34] Albrechts Hausmacht- und Frankreichpolitik führte so zum offenen Konflikt gerade mit den rheinischen Kurfürsten. In der folgenden Auseinandersetzung mit den Kurfürsten konnte sich der Habsburger behaupten und stand Ende 1302 als Sieger dar. Doch seine Pläne für eine Kaiserkrönung scheiterten ebenso wie ein Bündnis mit Frankreich, da es schließlich zum Bruch mit Philipp kam. Albrechts Ambitionen im Reich zielten derweil offenbar bis nach Böhmen, das er nach dem Aussterben der Přemysliden in männlicher Linie (1306) letztlich vergeblich versuchte, seinem Haus zu sichern.[35] In seinen letzten Monaten plante er ein erneutes Vorgehen in Thüringen gegen die Wettiner, die dort mit ihm um die Herrschaft konkurrierten, als er am 1. Mai 1308 dem Mordanschlag seines Neffen Johann zum Opfer fiel.

Nach Albrechts Tod wurde Ende 1308 überraschend der Luxemburger Heinrich VII. zum König gewählt.[36] Heinrich versuchte, das Kaisertum in Anlehnung an die Stauferzeit zu erneuern und Reichsrechte einzufordern (so im Westen und in Reichsitalien), gleichzeitig agierte er aber im Konsens mit den Großen; so verständigte er sich mit den Habsburgern und pflegte gute Beziehungen zu den Kurfürsten. Seine Herrschaft im deutschen Reichsteil war von einer seltenen Eintracht unter den großen Häusern geprägt, wovon sowohl der König als auch die Großen profitierten: Heinrich achtete die Interessen der Reichsfürsten und überspannte seine Hausinteressen nicht, während er umgekehrt auf die Unterstützung der Großen für seine weitgespannte Reichspolitik zählen konnte. Er gewann zudem im Sommer 1310 Böhmen für das Haus Luxemburg, das so zu einem der bedeutendsten Häuser im Reich aufstieg.[37] Die luxemburgische Machtbasis verschob sich in der Folgezeit denn auch immer mehr nach Osten. Heinrichs Politik zielte aber vor allem auf Italien und den westlichen Grenzraum, wo er die Expansion Frankreichs zu begrenzen versuchte, was zum Konflikt mit Philipp IV. führte. Bereits 1309 hatte Heinrich VII. seine Absicht erklärt, die Kaiserkrone erlangen zu wollen, wofür er sich mit Papst Clemens V. vorerst verständigen konnte. Hierbei kam Heinrich zugute, dass Clemens unter Druck Philipps IV. stand und sich wohl Entlastung vom römisch-deutschen König erhoffte; später allerdings schwenkte Clemens um.

Heinrich unternahm Ende 1310 einen Italienzug zur Erringung der Kaiserwürde,[38] der großes Aufsehen erregte und von zahlreichen italienischen Geschichtsschreibern geschildert wurde (unter anderem Albertino Mussato, Ferreto de’ Ferreti und Giovanni da Cermenate). In Reichsitalien geriet der König, der Herrschaftsrechte einforderte, die Finanzkraft der Kommunen nutzen und den Konflikt zwischen den Ghibellinen und Guelfen beenden wollte, aber bald zwischen die verfeindeten Blöcke. Heinrich hatte in Italien zahlreiche Konflikte mit aufständischen Städten auszutragen, wobei sein Hauptfeind das mächtige Florenz war, während etwa Pisa auf seiner Seite stand. Er geriet zudem in Streit mit dem Papst, da der Kaiser offen die alte universale Reichsidee wiederbelebte, was in den Proklamationen nach seiner Kaiserkrönung am 29. Juni 1312 in Rom deutlich zum Ausdruck kam, der ersten Kaiserkrönung seit 1220.[39] Heinrich ließ verkünden, dass, so wie Gott über alles im Himmel gebietet, alle Menschen auf Erden dem Kaiser zu gehorchen haben,[40] was scharfen Widerspruch von antikaiserlicher Seite und vom französischen König auslöste. Heinrichs Italienpolitik, die auf einen Ausgleich der verschiedenen kommunalen Kräfte gesetzt hatte, jedoch an den verschiedenen Eigeninteressen aller Seiten gescheitert war, strebte aber weiterhin die Wahrung von Reichsrechten an. Die Kämpfe in Reichsitalien dauerten an und die kaiserliche Seite war keineswegs sieglos. Im Sommer 1313 plante Heinrich einen Feldzug gegen das Königreich Neapel, wo Robert von Anjou offen gegen den Kaiser agiert hatte und deshalb wegen Majestätsverbrechen zum Tode verurteilt worden war, als er unerwartet am 24. August 1313 verstarb. Das wirtschaftlich bedeutende Reichsitalien, wo sich die lokalen Machthaber (Signoria) nun weitgehend durchsetzten, entglitt in der Folgezeit immer mehr dem (zuvor ohnehin nur begrenzten) Zugriff des römisch-deutschen Königtums.[41] In der neueren Forschung wird Heinrich VII. deutlich positiver bewertet als in der älteren.[42] So wird nun seine Anknüpfung an geläufige kaiserlich-universale Vorstellungen und sein durchaus von realpolitischen Motiven geleitetes Handeln betont.
Nach dem plötzlichen Tod Heinrichs VII. zogen sich der Wahlprozess ein gutes Jahr in die Länge, nachdem klar war, dass weder ein französischer Wahlvorstoß noch die Kandidatur von Heinrichs Sohn Johann, seit 1310 König von Böhmen und während des Romzugs Reichsvikar im deutschen Reichsteil, Erfolg haben würden. Wie schon 1308 spielten auch nun die rheinischen Kurfürsten eine wichtige Rolle, darunter Heinrichs Bruder, Balduin von Luxemburg, seit 1307 Erzbischof von Trier, der sich zu einem der bedeutendsten Reichspolitiker des 14. Jahrhunderts entwickeln sollte.[43] Im Oktober 1314 kam es schließlich zu einer Doppelwahl zwischen dem Wittelsbacher Ludwig, Herzog von Oberbayern, und dem Habsburger Friedrich dem Schönen, Herzog von Österreich. Ludwig konnte im Laufe der Zeit mehrere Anhänger für sich gewinnen, wenngleich weder er noch Friedrich päpstliche Unterstützung erlangten. Ludwig entschied die Thronfrage schließlich in der Schlacht von Mühldorf am 28. September 1322 zu seinen Gunsten, Friedrich geriet in Gefangenschaft. Im März 1325 wurde der Habsburger freigelassen; im September desselben Jahres unterschrieb er einen Vertrag mit Ludwig. Seitdem fungierte Friedrich bis zu seinem Tod im Jahr 1330 als Mitkönig des Wittelsbachers, wenngleich er keinen größeren Einfluss auf die Reichsgeschäfte ausübte.[44]

Die Regierungszeit Ludwigs IV. („der Bayer“) war von der Doppelwahl von 1314 bis zu seinem Tod 1347 von verschiedenen Konflikten geprägt.[45] Nach Beendigung des Thronstreits bestanden weiterhin ernsthafte Probleme, so im Hinblick auf das angespannte Verhältnis zum Papst, der nun in Avignon residierte und dort ganz unter dem Einfluss des französischen Königs stand (Avignonesisches Papsttum). Johannes XXII. hatte beiden Anwärtern die Anerkennung verweigert. Stattdessen erklärte er, ausgehend von der päpstlichen Approbationstheorie, dass es derzeit keinen rechtmäßigen römisch-deutschen König gab, da nur die päpstliche Approbation und nicht die Wahl der Kurfürsten entscheidend sei. Damit spitzte sich die Debatte um den bekannten päpstlichen Approbationsanspruch, der hier aus rein politischen Gründen von Johannes ins Spiel gebracht wurde, zu einem grundsätzlichen Konflikt zwischen dem römisch-deutschen Königtum und der Kurie in Avignon zu.[46] Hinzu kam eine brisante politische Komponente, da der Papst sich als „Vikar“ königliche Herrschaftsrechte aneignete. Der Streit um die päpstliche Approbation war somit der Kern des Konflikts zwischen Ludwig und auch den Kurfürsten (die auf die Wahrung ihres Wahlrechts bestanden) auf der einen, der Kurie auf der anderen Seite. Ebenso bestritt Johannes die Ausübung von Herrschaftsrechten in Reichsitalien. Der Konflikt führte schließlich dazu, dass Ludwig im März 1324 exkommuniziert wurde und sich auch in der Folgezeit nicht vom Kirchenbann lösen konnte.[47]
Der Konflikt mit dem Papsttum hatte allerdings zu der bereits erwähnten Versöhnung Ludwigs mit den Habsburgern beigetragen, da sich der Wittelsbacher so neuen Spielraum erhoffte. Ludwig konnte zumindest auf die Unterstützung der meisten Kurfürsten zählen, da die Einmischung des Papstes in die deutsche Königswahl empfindlich ihre ureigensten Machtinteressen tangierte und für eine antikuriale Stimmung gesorgt hatte. So kam es im Juli 1338 zum sogenannten Kurverein von Rhense, wo die sechs anwesenden Kurfürsten noch einmal ganz prinzipiell bekräftigten, dass nur ihre Wahl für die Besetzung des römisch-deutschen Königsthrons entscheidend war und die Wahl auch keiner päpstlichen Approbation bedurfte.[48] Ludwig hatte aber bereits zuvor selbstbewusst gehandelt und war im Januar 1327 zu einem Italienzug aufgebrochen, der ihm sogar die Kaiserkrone einbrachte.[49] Im Januar 1328 ließ er sich in Rom durch den stadtrömischen Adligen Sciarra Colonna zum Kaiser krönen. Mit diesem durchaus als radikal zu bezeichnenden Akt brach Ludwig allerdings – offensichtlich ganz bewusst – mit der mittelalterlichen Kaisertradition, wonach Krönungen vom Papst als einzig legitime Autorität vollzogen werden mussten. Der Papst reagierte empört mit Gegenmaßnahmen, wohingegen Ludwig 1328 sogar Johannes für abgesetzt erklärte und mit Nikolaus V. einen Gegenpapst einsetzte. Hierbei spielte dem Kaiser in gewisser Weise auch innerkirchliche Konflikte in die Hände, wie der ausgebrochene Armutsstreit. Insgesamt handelte es sich um einen bemerkenswerten Akt, der die theoretische Auseinandersetzung zwischen den beiden mittelalterlichen Universalgewalten neu entflammte und in dessen Zusammenhang es zu einer gelehrten Auseinandersetzung kam und an dem sich unter anderem Marsilius von Padua beteiligte.[50] Die folgenden Jahre waren weiterhin geprägt vom Kampf Ludwigs mit der Kurie, wobei es auch nach dem Tod Johannes’ XXII. 1334 zu keinem Ausgleich zwischen beiden Seiten kam.
Im Hinblick auf seine sonstige Reichspolitik regelte Ludwig 1329 im Hausvertrag von Pavia die Erbfolge im Hause Wittelsbach. Er kümmerte sich nach seiner Rückkehr aus Italien 1330 um seine Landesherrschaft, strebte den Gewinn der Mark Brandenburg für seinen Hausmachtkomplex an und engagierte sich auch stärker im ansonsten königsfernen Norden. Im 1337 ausgebrochenen Hundertjährigen Krieg stand er zunächst auf englischer, dann kurzzeitig auf französischer Seite.[51] Er geriet aber in zunehmenden Konflikt mit den Luxemburgern und einem Teil der Kurfürsten, die seine expansive Hausmachtpolitik missbilligten. Hinzu kam das weiterhin feindliche Verhältnis zum Papst (nun Clemens VI., der zur Wahl eines neuen Königs aufgerufen hatte). So wurde im Juli 1346 der Sohn Johanns von Luxemburg als Karl IV. von den fünf anwesenden Kurfürsten zum neuen römisch-deutschen König gewählt. Zu einem Kampf zwischen Karl und Ludwig kam es nicht mehr, da letzterer im Oktober 1347 verstarb.[52]
Schwarzer Tod und Judenverfolgung

In dieser Zeit brach überraschend in ganz Europa eine schwere Pest aus, der sogenannte „Schwarze Tod“ (1347 bis 1353). Es handelte sich um die verheerendste Seuchenwelle des Spätmittelalters und sogar um die bislang schlimmste Pandemie der Menschheitsgeschichte, als dessen Krankheitserreger das Bakterium Yersinia pestis gilt.[53] Neuere Forschungen haben diese Theorie in einer 2022 veröffentlichten Studie bestätigt.[54] In einer Studie aus dem Jahr 2025 werden auch Umweltfaktoren geltend gemacht: So habe ein Vulkanausbruch (wohl in den Tropen) zu einer Klimaverschlechterung geführt, der dadurch verursachte Temperaturfall habe Missernten verursacht, was wiederum einen erhöhten Bedarf für Getreide zur Folge hatte. Die Getreidelieferungen seien dann mit Flöhen verseucht gewesen, die den Pesterreger transportierten.[55] Die Pandemie hatte ihren Ursprung in Zentralasien, gelangte über die Handelsrouten zunächst in den östlichen Mittelmeerraum und verbreitete sich dann weiter in ganz Europa.[56]
Spätmittelalterliche Chronisten berichteten schon bald vom Ausbruch der Pest in weit entfernten Regionen Asiens, wie in Persien und China.[57] Für das Frühjahr 1347 ist der Ausbruch der Seuche am Schwarzen Meer belegt, sie verbreitete sich dann rasch weiter nach Westen, erreichte noch im selben Jahr Konstantinopel und bald darauf Italien und den westlichen Mittelmeerraum.[58] In den zeitgenössischen Berichten wird die Panik über die unaufhaltbar scheinende Krankheit und die damit einhergehenden hohen Todeszahlen überaus deutlich.[59] 1348 wurde zu einem Katastrophenjahr, die Quellenzeugnisse[60] aus diversen Städten („In den Berichten über die Pest ist diese fast immer ein städtisches Ereignis.“[61]) sind diesbezüglich sehr eindrücklich, wobei der Tod alle Bevölkerungsschichten traf. Im nordalpinen Reichsteil des Imperiums sind die ersten Ausbrüche in Bayern nachweisbar, wobei unter anderem örtliche Chroniken und lokale Annalen die Ereignisse schildern. Wohl bereits im Sommer 1348 ereigneten sich vereinzelte Pestausbrüche im südlichen Bayern. In Passau brach die Pest im Herbst 1348 aus und verbreitete sich dann weiter im Land,[62] doch begrenzten sich die Pestausbrüche 1348 noch auf den Südosten; Ende 1348 scheint auch Augsburg betroffen gewesen zu sein.[63] Im folgenden Jahr breitete sich die Seuche dann weiter nach Südwesten und nach Norden aus. Ende 1349[64] erreichte die Pest Köln, die größte Stadt des deutschen Reichsteils.
Wie viele Menschen in dieser Zeit gestorben sind, ist aufgrund der problematischen Quellenlage nur ungefähr zu ermitteln. Klaus Bergdolt schreibt dazu: „Berücksichtigt man Steuerlisten, Taufregister, Pfarrbücher, Zunftverzeichnisse usw., bestätigt sich eher die alte Vermutung, dass zwischen 1347 und 1351 von 75 bis 80 Millionen Europäern etwa ein Drittel starb. Der endgültige Bevölkerungstiefstand war, Folge weiterer Epidemien und Naturkatastrophen, allerdings erst gegen 1400 erreicht.“[65] Manche Forscher gehen von weitaus mehr Toten aus, so Ole J. Benedictow, ein auf die Geschichte der Pest spezialisierter norwegischer Historiker. Dieser hat in seiner umfassenden Untersuchung zum Schwarzen Tod zahlreiche Studien ausgewertet, wobei er betont, dass die Quellenlage regional sehr unterschiedlich ist; doch dürfte ihm zufolge die Sterblichskeitsrate sogar eher um die 60 % betragen haben.[66] Teilen der deutschen Forschung wirft er vor, die Sterblichkeitsrate viel zu gering veranschlagt zu haben, während die Auswertung regionaler Quellen ein noch düstereres Bild von den Auswirkungen der Pest im Reich zeichnet.[67] Wenngleich er sich kritisch etwa zu Bergdolt äußert,[68] hat dieser Benedictows Werk übrigens positiv besprochen.[69]

Die Pest erschütterte die sozialen und wirtschaftlichen Strukturen nachhaltig.[70] Sie schürte des Weiteren gesellschaftliche Ängste und Konflikte. Die wohl bekannteste Folge waren, geschürt durch ohnehin bereits vorhandene Vorurteile, die Judenverfolgungen zur Zeit des Schwarzen Todes.[71] Pogrome fanden vor allem im römisch-deutschen Reich statt, so unter anderem in Würzburg, Straßburg, Nürnberg und Frankfurt am Main. Juden wurden bezichtigt, verantwortlich für die Seuche zu sein oder in anderer Art und Weise böswillig gehandelt zu haben (Brunnenvergifter). Dahinter mochte echte Judenfeindlichkeit stecken, denn die zeitgenössischen Berichte sind voll hasserfüllter Anklagen gegen die Juden.[72] Es mochte aber oft auch nur als Vorwand dienen, denn viele Juden wurden nicht nur ermordet, sie wurden ebenfalls ihres Besitzes beraubt und dieser dann verteilt. Gleichzeitig wurden so oft Schulden getilgt, da jüdische Kredite eine wichtige Rolle im Wirtschaftsleben spielten.[73] In diesem Zusammenhang wirkten auch antijüdische Stereotypen von gierigen Geldverleihern.[74] Von den Pogromen profitierten nicht nur Bürger bzw. der herrschende Stadtrat, sondern ebenso Karl IV. Dieser verfügte in seiner Eigenschaft als römisch-deutscher König auch über das Judenregal, wonach er zum Schutz der Juden verpflichtet war (kaiserliche Kammerknechtschaft); allerdings erwies sich die kaiserliche Schutzfunktion immer mehr als brüchig, zumal es auch zu Verpfändung von Judenregalien an lokale weltliche und geistliche Obrigkeiten kam.[75] Karl war sogar teilweise ein Profiteur der Judenmorde und wusste wohl im Vorfeld zumindest von einigen Pogromen. So übertrug er am 27. Juni 1349 jüdisches Eigentum in Nürnberg an den brandenburgischen Markgrafen Ludwig – und zwar sobald die Juden dort nächstens erschlagen seien („wann die Juden da selbes nu nehst werden geslagen“[76]). Im selben Jahr erließ Karl eine Straffreiheit für die an den Judenmorden in Nürnberg beteiligten Personen und gestattete den Abriss ehemals jüdischen Eigentums. Der König stärkte gerade in Nürnberg Personen, die ihm politisch von Vorteil waren. Dieses Handeln wirft einen tiefen Schatten auf den Charakter Karls, der aber nicht nur in seiner Rolle als König versagte, indem er die auf seinen Schutz vertrauenden Juden außerhalb seines Hausmachtkomplexes (wo er durchaus schützend eingriff) im Stich ließ, es zeigt sich außerdem eine „Dynamik aus skrupellosem Machtschacher, Raffgier und religiösen Ressentiments“.[77]
Karl IV. – Hegemoniales Königtum?

Karl IV. gilt bis heute als der wohl bedeutendste spätmittelalterliche römisch-deutsche Herrscher.[78] Der Sohn des böhmischen Königs Johann war gebildet, hatte vor seiner Königswahl bereits Regierungserfahrung sammeln können und erwies sich als geschickter Politiker. Seine Regierungszeit (1346/49 bis 1378) sollte zudem wichtige Weichen für die zukünftige Entwicklung stellen, war neben Höhepunkten (wie der Erweiterung des luxemburgischen Hausmachtkomplexes) aber auch von Krisen (wie der oben beschriebenen Pestwelle) geprägt.[79] Bereits 1347 hatte er nach dem Tod seines Vaters die böhmische Königskrone erhalten. Als böhmischer König kümmerte er sich intensiv um die Landesherrschaft und baute seine Hauptresidenz Prag prächtig aus, wo er 1348 die Universität Prag gründete, die erste im Reich nördlich der Alpen. Ebenso betätigte er sich als Kulturförderer. Nach dem Tod Ludwigs IV. 1347 wurde Karl als neuer römisch-deutscher König seit 1349 zudem allgemein anerkannt, erhielt päpstliche Unterstützung und konnte sich mit den Wittelsbachern verständigen.

1356 erließ Karl zusammen mit den Kurfürsten (denen er durchaus Zugeständnisse machen musste) die Goldene Bulle, womit die Reichsverfassung neu geordnet wurde.[80] Mit ihr wurde der Kreis der nun sieben Kurfürsten, die zur Königswahl zugelassen waren, offiziell festgelegt (wobei die Luxemburger die böhmische Kurstimme führten), ebenso die Wahl mit einfacher Mehrheit. Doch wurde die königliche Macht durchaus begrenzt, die Stellung der Kurfürsten und indirekt auch der anderen Landesherren gestärkt. Denn nur durch die Mitwirkung der Kurfürsten waren die Regelungen durchsetzbar. Einig waren König und Kurfürsten dafür in verschiedenen Punkten. So regelte die Bestimmungen unter anderem die Nachfolgeregelungen in den Kurfürstentümern und beugte uneindeutigen Königswahlen vor, was stabilisierend wirkte. Die Goldene Bulle gehört damit zu den wichtigsten Reichsgesetzen und bildete in gewisser Weise das Grundgesetz des Reiches. Abgelehnt wurde einhellig der päpstliche Approbationsanspruch: Die Wahl der Kurfürsten alleine war damit in der folgenden Zeit für die römisch-deutsche Königswahl ausschlaggebend. In diesem Sinne symbolisiert die Goldene Bulle weniger eine königliche Machtvollkommenheit, sondern vielmehr den konsensualen Charakter der Herrschaftspraxis im spätmittelalterlichen Reich. Während sie unbestreitbar Vorteile bot, musste sie in der Praxis doch mit politischen Handeln unterfüttert werden. Erst durch die Entwicklung in den folgenden Jahrzehnten, in denen das Kurfürstenkollegium stärker kooperativ auftrat, gewann sie ihre eigentliche Bedeutung: „Zu ihrer Entstehungszeit war sie ein Privileg für nur wenige Empfänger mit zeitlich begrenzter Geltung, dessen weitere Zukunft mit dem steilen Aufstieg zur lex fundamentalis des Reiches nicht vorausgesehen werden konnte.“[81]

Karl IV. herrschte über einen bedeutenden Hausmachtkomplex, der neben den erweiterten luxemburgischen Stammlanden im Westen auch Böhmen und Mähren im Osten umfasste. In seiner weiteren Regierungszeit sollte Karl seine Hausmacht noch um bedeutende Gebiete wie die Niederlausitz (1368) und nicht zuletzt die Mark Brandenburg (1373) erweitern, wobei dieser Erwerb mit der brandenburgischen Kurstimme bei der Königswahl einherging. Ebenso sicherte sich Karl endgültig Schlesien.[82] In Franken und der Oberpfalz („Neuböhmen“) verfügte er über Streubesitz, wobei die Reichsstadt Nürnberg eine wichtige Rolle in Karls Politik spielte. Zweifellos war Karl ein überaus geschickter Politiker, der sich hervorragend auf das Machtspiel der großen Häuser im Reich verstand und den luxemburgischen Hausmachtkomplex erheblich erweiterte und stärkte.[83] Statt auf militärische Konflikte setzte er auf Diplomatie. Dafür nutzte der König seine Kinder, verheiratete sie und zielte damit nicht zuletzt so auf entsprechende Erbansprüche.[84] Während Karl die luxemburgische Hausmacht vergrößerte, gab er gleichzeitig Reichsgut auf, was sicherstellte, dass nachfolgende Könige sich noch stärker als zuvor vor allem auf ihren eigenen Besitz stützen mussten, womit die Luxemburger erheblich im Vorteil waren. Karls Hausmachtpolitik und seine Politik gegenüber den Reichsfürsten war so erfolgreich, dass man sie in der Forschung auch als „hegemoniales Königtum“ bezeichnet hat: Gestützt auf seine erheblich Hausmacht habe der römisch-deutsche König damit erstmals seit gut 100 Jahren wieder als politisch Ebenbürtiger gegenüber dem Papst und den anderen europäischen Herrschern auftreten können, während er gleichzeitig im Reich für geordnete Verhältnisse gesorgt und das Königtum in Verknüpfung mit den Kurfürsten gestärkt habe.[85] Seinen Sohn Wenzel setzte er (noch zu seinen Lebzeiten) sogar 1376 als römisch-deutschen König durch, wofür er freilich mehrere Wahlversprechen machen musste.
Die Königskrone konnte Karl seinem Sohn nur deshalb sichern, weil er zuvor selbst die Kaiserkrone erlangt hatte. 1354 war Karl nach Italien gezogen und war am 5. April 1355 in Rom zum Kaiser gekrönt worden. Im Gegensatz zu seinem direkten Vorgänger Ludwig hatte Karl jeden Konflikt mit dem Papst vermieden, verzichtete aber auch auf die von seinem Großvater Heinrich VII. so energisch verfolgte Italienpolitik alten Stils. Karl IV. begnügte sich mit den teils hohen Geldzahlungen der Kommunen, mischte sich aber nicht weiter in die reichsitalienischen Angelegenheiten ein und kehrte schon 1355 wieder über die Alpen zurück.[86] Dies mochte realpolitisch klug erscheinen, wenngleich in mehreren italienischen Quellen die Kaiserkrönung begrüßt wurde, allerdings waren die reichsitalienischen Machthaber eher an der Legitimierung ihrer Machtstellung interessiert und daher zu Zahlungen an den Kaiser bereit.[87] Der zweite Italienzug 1368/69 hatte ebenfalls eine sehr begrenzte Zielsetzung.[88] Papst Urban V. hatte beabsichtigt, die Kurie wieder von Avignon nach Rom zu verlegen, wozu es aber nicht kam, wobei Karl erst spät in Italien erschien und dabei wieder Gelder eintrieb. An einer Erneuerung der Reichsherrschaft in Italien war der Kaiser nicht interessiert.

Im Westen begnügte sich Karl ebenfalls mit eher symbolischen Gesten in der Reichspolitik. So ließ er sich zwar 1365 in Arles mit der Königskrone Burgunds krönen,[89] ein höchst seltenes Ereignis, wenngleich Burgund (Arelat) neben Deutschland und Reichsitalien der dritte Reichsteil des Imperiums war. Allerdings legte Karl mehr Wert auf gute Beziehungen zum französischen Königshof und tat kaum etwas, um Reichsrechte im westlichen Grenzraum zu wahren, wieder ganz im Gegensatz zu Heinrich VII. Bemerkenswert ist aber, dass Karl IV. zumindest formal am kaiserlichen Hoheitsanspruch festhielt, sich in der Praxis aber flexibel verhielt. Als der Kaiser 1377 nach Frankreich reiste[90] und kurz vor Weihnachten in Cambrai eintraf, wurde er von einer hochrangigen französischen Delegation empfangen, die dem Kaiser erklärte, dass er zur Weihnachtsmesse die Lesung aus dem Lukasevangelium keinesfalls in Paris halten könne. Denn aus der betreffenden Stelle (Lukas 2,1) ging hervor, dass das (römische) Kaisertum älter als die Kirche war; ebenso umgab sich der Kaiser mit einer zusätzlichen Aura der Sakralität und drückte seinen hervorgehobenen Rang gegenüber den Mitkönigen des lateinischen Europas aus.[91] Dies wurde von französischer Seite offenbar erkannt, der Kaiser lenkte denn auch ein. Wenngleich Karl IV. die formale kaiserliche Vorrangstellung durch die Verlesung des Lukasevangeliums zu untermauern versuchte, ist die beschriebene Episode doch bezeichnend für die neuen politischen Verhältnisse, wonach „außenpolitische Beziehungen“ mehr oder weniger von gleich zu gleich betrieben wurden. Johannes Fried schreibt dazu: „Zum ersten Mal begegneten ein Kaiser und ein römischer König dem König Frankreichs in dessen eigenem Land [...] Dieses Kaisertum hatte Abschied genommen von allen Weltherrschaftsträumen, hatte endgültig gebrochen mit den Weltkaiser-Doktrinen, wie sie am Hof der Staufer und zuletzt noch Ludwigs des Bayern kursierten.“[92] Für seine dynastischen Interessen gab der Kaiser Reichsrechte in Burgund faktisch auf, wenngleich er wenigstens Genf und Savoyen direkt in den deutschen Reichsteil einfügte.
Doch kurz nach dem Tod Karls IV. zeigten sich bereits Brüche im politischen System, das er so geschickt errichtet hatte. Die Regierungszeit seines Sohnes Wenzel sollte dann zum vorläufigen Zusammenbruch der luxemburgischen Herrschaft im Reich führen.
Vom Scheitern König Wenzels bis zum Tod Kaiser Sigismunds

Wenzel, noch sehr jung in der Regierungszeit Karls IV. 1376 zum römisch-deutschen König gekrönt und nun auch König von Böhmen, konnte nicht an die politischen Erfolge seines Vaters anknüpfen.[93] Schlimmer noch: In der Forschung wird seine Regierungszeit (1378 bis 1400) als eine Phase des Scheiterns verstanden, er selbst als mit der komplexen Herrschaftsausübung persönlich überfordert.[94] Wenzel erbte einen gewaltigen Hausmachtkomplex, stand aber auch vor schwierigen Herausforderungen. 1378 war es zu einer Papstdoppelwahl gekommen, nachdem Urban VI. den französischen Einfluss in der Kurie eindämmen wollte und der Umzug nach Rom immer stärker gefordert wurde. Daraufhin wurde Clemens VII. zum Gegenpapst erhoben. Dies war der Beginn des Abendländischen Schismas, das die lateinische Christenheit fortan bis 1417 tief spalten sollte, mit einem Papst in Avignon und einem Papst in Rom.[95] Anders als zuvor endete diese Spaltung nicht mit dem Tod der beiden Päpste, vielmehr war die Spaltung diesmal tiefgehender, schien lange Jahre unüberbrückbar zu sein und sorgte für Instabilität.[96] Vom römisch-deutschen König, der als potentieller Kaiser in einer nach wie vor besonderen Beziehung zum Papst stand, wäre zu erwarten gewesen, aktiv tätig zu werden. Wenzel entschied sich, für Urban Partei zu ergreifen, doch trug dies nichts zur Lösung an sich bei.
In Reichsangelegenheiten agierte der König wenig entschlossen. Gleichzeitig konnte er nicht auf die vollkommene Unterstützung in seinem eigenen Haus bauen. Die Kurfürsten waren über das Verhalten des Königs, der einer geplanten Reichsversammlung fernblieb, derart verärgert, so dass drei der rheinischen Kurfürsten ihn im Januar 1380 offen aufforderten, sich stärker um die Reichsangelegenheiten zu kümmern oder aber einen Reichsvikar zu bestellen.[97] Dies war ein unmissverständliches Warnzeichen für den jungen König. Gleichzeitig entwickelte sich ein Konflikt zwischen verschiedenen aufstrebenden Städten und umliegenden Fürsten, da letztere die städtischen Rechte zu beschneiden versuchten. Der Konflikt konnte aber 1389 mit einem in Eger verkündeten Landfrieden vorerst beendet werden, wobei Wenzel den Städten finanzielle Anreize bot.[98] Ziel Wenzels war außenpolitisch die Kaiserkrone, doch seine Versuche seit 1380, diese zu erlangen, scheiterten. Sein Bruder Sigismund machte seine Erbansprüche auf das Königreich Ungarn geltend und konnte sich 1387 dort durchsetzen.[99] Wenzel sah sich aber bald schon mit den Plänen seines Verwandten Jobst von Mähren, nun neuer Markgraf von Brandenburg, konfrontiert, der Wenzels Absetzung plante.[100] In dieser Situation beging Wenzel mehrere Fehler, so 1395, als er ohne Konsultation mit den Kurfürsten Gian Galeazzo Visconti zum Herzog von Mailand erhob, womit er Reichsrechte gemindert hatte, während auch in seinem Stammland Böhmen der Widerstand gegen die sprunghaft wirkende Politik des Königs anwuchs, was zur Bildung des sogenannten Herrenbunds führte. Wenzel sah sich somit in einer politisch verzweifelten Situation, da in Böhmen 1398/99 offene Kämpfe ausbrachen, er mit innerfamiliären Konflikten beschäftigt war (sowohl Jobst als auch Sigismund spekulierten auf die römisch-deutsche Königskrone) und ihm auf Reichsebene der Rückhalt fehlte. Die rheinischen Kurfürsten konkretisierten ihre Absetzungspläne und schlossen sich 1399 zur Wahrung ihrer Rechte zusammen. Der König wurde vorgeladen und, nachdem er der Aufforderung nicht nachkam, im August 1400 für abgesetzt erklärt, da er „unnützer, versäumlicher, unachtbarer Entgliederer und unwürdiger Handhaber des heiligen Römischen Reiches“ sei.[101]
Die Absetzung wird in den Quellen insgesamt positiv dargestellt. Wenzel reagierte wütend und verzichtete nie auf die Krone, war aber machtlos. Damit war die Konzeption Karls IV., ein auf die Hausmacht gestütztes, quasi-erbliches Königtum zu etablieren, grandios gescheitert.[102] Bemerkenswert ist das Vorgehen des Kurfürstenkollegiums auch verfassungsgeschichtlich, da sie aus ihren Rechten ableiteten, nicht nur den römisch-deutschen König zu wählen, sondern ihn gegebenenfalls auch absetzen zu können. Diese Rechte leiteten sie aber nur ab, denn die Goldene Bulle sah kein Absetzungsrecht vor. Dafür nutzten die Kurfürsten nun als Kontrastfolie die geläufigen Verpflichtungen eines Königs und sprachen diese Wenzel durch sein angebliches Fehlverhalten ab.[103] Sie erwarteten von einem König, dass dieser Reichsinteressen und Reichsrechte wahrte und nicht leichtfertig veräußerte, wie die Absetzungserklärung verrät. Die Wahrung der eigenen Interessen durch die Kurfürsten schloss keineswegs aus, dass man einen möglichst fähigen König wählte, von dem dann freilich erwartet wurde, dass er die kurfürstlichen Interessen berücksichtigte und respektierte.

Die Kurfürsten wählten umgehend Ruprecht von der Pfalz, als Pfalzgraf bei Rhein selbst einer der vier rheinischen Kurfürsten, zum neuen König.[104] Das brennendste Problem von Ruprechts Regierungszeit (1400 bis 1410) war die sich verschärfte finanzielle Notlage des römisch-deutschen Königtums.[105] Ruprecht verfügte mit durchschnittlich rund 17.500 Florin jährlich nur über einen Bruchteil der Einnahmen, die Karl IV. zur Verfügung gestanden hatten.[106] Ruprechts eigene bescheidene Hausmacht konnte nicht kompensieren, dass das wenig verbliebene Reichsgut nach den Verpfändungen der vergangenen Jahrzehnte keine ausreichende Grundlage mehr bot. Regelmäßig fließende Einnahmen waren spärlich und gering, wohingegen adelige und städtische Privilegien dem König enge Grenzen setzten; Ruprecht musste daher selbst Güter verpfänden und sich verschulden, wobei das grundlegende Problem hierbei das strukturelle Defizit war, das aus der fehlenden Liquidität resultierte.[107] Ein Aspekt von Ruprechts Regierungszeit erwies sich allerdings als zukunftsweisend: Die Etablierung einer dauerhaften Reichskanzlei. Obwohl der königliche Hof im Spätmittelalter verstärkt das Zentrum herrschaftlichen Handelns war und die Bedeutung der Schriftlichkeit für die Herrschaftsausübung stetig zunahm, stand das entsprechende Kanzleipersonal nach dem Tod eines Königs dem neuen Herrscher oftmals nicht zur Verfügung. Vielmehr musste sich bis ins ausgehende Spätmittelalter jeder neue römisch-deutsche König im Grunde auf die eigene Verwaltung stützen bzw. eine neue etablieren, die dann die Funktion einer Reichsverwaltung ausübte. Nach dem Tod König Ruprechts 1410 wurden jedoch die Register von dessen hervorragend geführten Kanzlei von seinem Nachfolger Sigismund übernommen und später weiter fortgeführt, wodurch eine größere Verwaltungskontinuität gewährleistet wurde.[108]
Ohne eigene größere Hausmacht musste sich Ruprecht auf die Reichsstädte und den königsnahen Adel stützen. In der Reichspolitik war er aber wenig erfolgreich, wie seine gescheiterten Bemühungen um die Landfriedenspolitik im Reich, der Konflikt mit dem Marbacher Bund und eine vergebliche Lösung des andauernden Schismas zeigen. Der Italienzug Ruprechts 1401/02, der sich unter anderem gegen Gian Galeazzo Visconti in Mailand richtete und wofür der König Kredite aufnehmen musste, war ebenfalls erfolglos und mit einem Prestigeverlust verbunden. Die Kaiserkrone rückte damit in weite Ferne, ebenso wie die vage Hoffnung, die Finanzkraft in Reichsitalien nutzen zu können. Ruprecht agierte als König glücklos, doch waren die strukturellen Probleme bei seinem Herrschaftsantritt wohl zu gravierend und man wird ihm seine Bemühungen kaum absprechen können.[109] Erkennbar waren die offenkundigen Strukturprobleme des Königtums, vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht. Nach seinem Tod setzte sich der Luxemburger Sigismund als König durch und erneuerte den luxemburgischen Herrschaftsanspruch im Reich, doch auch er stand vor ganz ähnlichen Problemen.

1411 wurde Wenzels Halbbruder Sigismund zum römisch-deutschen König gewählt.[110] 1410 war zunächst Jobst von Mähren in einer konkurrierenden Wahl mit Sigismund als neuer König gewählt worden, nach seinem überraschenden Tod Anfang 1411 trat nun jedoch Sigismund nach erneuter Wahl das Amt an. Dieser hatte sich stets als sehr ehrgeizig erwiesen. Sein Verhältnis zu Wenzel (der bis zu seinem Tod 1419 böhmischer König blieb) war angespannt, so hatte Sigismund seinem Bruder Unterstützung in Böhmen und im Reich versprochen, dafür zahlreiche Machtbefugnisse erhalten, dann aber seine eigenen Interessen verfolgt, was 1402 zu einer offenen Konfrontation und der kurzzeitigen Inhaftierung Wenzels geführt hatte. Sigismunds Versuch, die böhmische Krone zu erlangen, war 1405 gescheitert.[111] Sigismund war zudem seit 1387 König von Ungarn, wo er zunächst einen schweren Stand gehabt hatte, jedoch nach und nach seine Königsherrschaft konsolidieren konnte. Als ungarischer König verfügte er über einen beträchtlichen politischen Aktionsradius, der weite Teile Südosteuropas einschloss, doch war seine Regierungszeit auch von schweren Rückschlägen wie der vernichtenden Niederlage in der Schlacht von Nikopol (1396) gegen das nun auf europäischen Boden expandierende Osmanische Reich geprägt gewesen.[112] Sigismunds Königtum stand so von Beginn an unter einem gewissen Legitimationsdruck. Ein drängender Punkt war die Lösung des Schismas, woran Wenzel und Ruprecht gescheitert waren. Sigismund konzentrierte sich nun darauf, was ihm als zukünftigen Kaiser außerdem erhebliches Prestige versprach.

Sigismund gelang es 1414, das später berühmte Konzil von Konstanz einzuberufen, das bis 1418 tagte und über das uns neben den Konzilsakten die Chronik des Ulrich Richental gut unterrichtet. Dort sollten vor allem drei Fragen geklärt werden: Beendigung des Schismas (zu diesem Zeitpunkt beanspruchten sogar drei Päpste das Amt für sich), Kirchenreform und das Problem der kirchenkritischen Bewegung um Jan Hus in Böhmen.[113] Sigismund spielte dort als „Konzilsvogt“ eine wichtige Rolle, wenngleich er anscheinend die Schwere der Aufgabe zunächst unterschätzt hatte.[114] Papst Johannes XXIII., der selbst in Konstanz erschienen war, wurde im Mai 1415 für abgesetzt erklärt, ebenso Benedikt XIII., während Gregor XII. zum Rücktritt bewegt wurde. Mit der Wahl von Martin V. im November 1417 wurde das Schisma überwunden, was ein bedeutender Erfolg war.[115] Nicht durchsetzen konnte Sigismund eine Beschränkung der päpstlichen plenitudo potestatis, da sein Einfluss auf dem Konzil nach der Wahl Martins V. weitgehend erlosch. In der eng mit der causa fidei (Glaubensfrage) verknüpften Angelegenheit um Jan Hus entwickelte sich ein unrühmlicher Vorgang. Dem böhmischen Reformer, der die Lehren John Wyclifs gegen die kirchliche Obrigkeit verteidigt hatte, war freies Geleit nach Konstanz zugesichert worden, dennoch wurde er dort wegen Ketzerei verurteilt und am 6. Juli 1415 hingerichtet.[116] Der Vorgang hatte weitreichende Folgen, denn seine Anhänger reagierten verständlicherweise mit Empörung und offenen Widerstand, der zu den sogenannten Hussitenkriegen führte. Die Kirchenreform konnte nicht vollendet werden und führte nur zu bescheidenen Fortschritten. Dem Dekret Frequens zufolge sollten weitere Konzile tagen, um die causa reformationis abzuschließen (siehe auch Konzil von Pavia und Konzil von Basel),[117] doch wurde die Frage nicht zufriedenstellend geklärt, was schließlich zur Reformation führte.
Im Rahmen der Reichspolitik intervenierte Sigismund bereits 1412 in Reichsitalien gegen die Republik Venedig und Ladislaus von Neapel (ein ehemaliger Konkurrent Sigismunds um die ungarische Königskrone). Im April 1413 konnte Sigismund gegenüber Venedig zumindest Teilerfolge verbuchen und vermied so eine kostspielige und längerfristige Konfrontation.[118] Nachteilig wirkte sich jedoch aus, dass Sigismund dem Mailänder Herrscher Filippo Maria Visconti die Herzogswürde verweigerte und so die Bildung eines mächtigen Bündnisses zwischen Mailand, Neapel und Venedig herbeiführte, das die luxemburgische Italienpolitik empfindlich störte.[119] Im Westen bemühte sich der König um die Wiederherstellung von Reichsrechten (so im Hinblick auf das aufstrebende Burgund, das eine zunehmend eigenständige Politik betrieb), pflegte aber gleichzeitig gute Beziehungen zu Frankreich und ebenso zu England, was eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen des Konzils gewesen ist.[120] Im deutschen Reichsteil, das Sigismund erst 1414 erstmals seit seiner Wahl von 1411 wieder betrat, sah er sich mit den bekannten strukturellen Problemen konfrontiert. So verfügte er im deutschen Reichsteil über keine nennenswerte Hausmacht mehr; nicht einmal alle luxemburgischen Hausgüter standen ihm beim Herrschaftsantritt zur Verfügung und seine Einnahmen beliefen sich anfänglich auf nur rund 13.000 Florin.[121] Ungarn selbst konnte ihm außerdem nicht als Machtbasis für seine Reichspolitik dienen, so dass seine Ausgangsbasis ungünstig war.[122] Er vernachlässigte aber nicht die allgemeinen Reichsgeschäfte, zumal die Rechts- und Friedenswahrung zentrale königliche Aufgabenfelder waren. Sigismund bemühte sich um die Durchsetzung des Landfriedens, die Schlichtung mehrerer lokaler Streitigkeiten, hatte aber auch mit Konflikten innerhalb der Häuser Habsburg und Wittelsbach zu kämpfen.[123] Nach Wenzels Tod 1419 trat Sigismund die Nachfolge als böhmischer König an, wo er in Konflikt mit den Hussiten geriet; gleichzeitig musste sich Sigismund in seiner Rolle als ungarischer König um die Abwehr der Türken kümmern.[124]
Bei den Reichsständen wurde das Engagements des Königs (der nun in Böhmen und teils Ungarn gebunden war) im Reich allerdings zunehmend als unzureichend betrachtet, was die Kurfürsten für ihre eigenen Interessen nutzten. So sah sich Sigismund dazu gezwungen, sich um eine Intensivierung seiner Beziehungen zu den Reichsstädten und der zunehmend an Einfluss verlierenden Ritterschaft zu bemühen. All dies führte jedoch nicht zum erhofften Erfolg, denn trotz jahrelanger politischer Aktivitäten kam es 1434 zum Abbruch aller weiteren Verhandlungen, womit Sigismunds Reichspolitik in einem zentralen Punkt gescheitert war.[125] 1433 sollte jedoch noch die von ihm sehnlichst erwünschte Kaiserkrönung gelingen, womit er der dritte Luxemburger war, der die höchste weltliche Würde der lateinischen Christenheit erringen konnte. Der gut zweijährige Romzug von 1431 bis 1433 verlief insgesamt unproblematisch, wobei Sigismund vor allem finanzielle Unterstützung toskanischer Stadtrepubliken erhielt (besonders gute Kontakte pflegte der Kaiser zu Siena) und nicht in die interkommunalen Machtkämpfe verwickelt wurde.[126] Zu einem von ihm angestrebten Kreuzzug gegen die Türken kam es aber nicht mehr, wobei er als Kaiser und ungarischer König (dessen Machtbefugnisse begrenzt waren) die Gefahr klar erkannte. Und wenngleich sich Sigismunds Verhältnis zu den Kurfürsten am Ende seiner Regierungszeit als kooperativ erwies, gelang es nicht, eine notwendige Reichsreform umzusetzen. Als Sigismund am 9. Dezember 1437 verstarb, blieb viel von seinem Regierungshandeln unvollendet. In Verwaltungs- und Finanzierungsfragen bestanden ungelöste Probleme, die Aussöhnung politisch zerstrittener Parteien, ungelöste religiöse Konflikte und materielle Probleme erwiesen sich als kaum zu bewältigen. Einen pflichtbewussten Arbeitseifer, Intelligenz, einen extrem weitgespannten diplomatischen Aktionsradius und die Verdienste bei der Beendigung des Schismas sind dem Kaiser aber nicht abzusprechen. Speziell die strukturellen Defizite des römisch-deutschen Königtums und die zeitspezifische Ausgangsbasis Sigismunds (neben freilich vorhandenen persönlichen Fehlern) sind hierbei zu berücksichtigen.[127]
Von der Hausmacht zur habsburgischen Großmacht
Die Nachfolge Sigismunds als römisch-deutscher König trat im März 1438 sein Schwiegersohn, Herzog Albrecht von Österreich an, der 1422 Sigismunds Tochter Elisabeth geheiratet hatte. Als Albrecht II. sollte er nur etwas über ein Jahr regieren, doch legte seine Nachfolge nicht nur als römisch-deutscher König, sondern auch als König von Böhmen die Grundlage für die Herrschaft der Habsburger im Reich, die diese bis zum Ende des Alten Reichs 1806 fast durchgehend behaupten konnten.[128] Albrecht folgte Sigismund auch als König von Ungarn und Kroatien nach, doch sollten die Habsburger das ungarische Erbe nicht behaupten können. In Ungarn musste Albrecht zunächst die Türken abwehren, im Rahmen der Kriegsvorbereitungen gegen sie ist er dort am 27. Oktober 1439 verstorben. Das eigentliche Reichsgebiet hatte er somit nicht mehr betreten, dennoch war er über die von seinem Vorgänger übernommenen Berater in der Reichspolitik aktiv. So wollte er wohl zunächst seine Herrschaft in Ungarn und Böhmen sichern, um anschließend Reformen anzugehen, die offensichtlich notwendig waren.[129]

Albrechts Nachfolge trat der Habsburger Friedrich III. an.[130] Seine überaus lange Regierungszeit (1440 bis 1493) war geprägt von Konflikten zur Sicherung der habsburgischen Hausmacht und gegen äußere Widerstände, besonders im Hinblick auf Ungarn. In die engere Reichspolitik sollte Friedrich, seit 1452 auch Kaiser, nur phasenweise effektiv eingreifen, seine Politik im Westen führte aber zur beträchtlichen Erweiterung des habsburgischen Herrschaftskomplexes unter seinem Sohn Maximilian, dessen Königskrönung er 1486 erreichen konnte (siehe unten).[131] Aufgrund der Masse des Quellenmaterials (vor allem Urkunden und Briefe) für die Regierungszeit Friedrichs III. besteht bei der Arbeitsstelle der Regesta Imperii ein speziell gefördertes Langzeitvorhaben mit einer umfassenden Publikationsliste.[132] In diesem Zusammenhang wird die Regierungszeit des Kaisers inzwischen positiver bewertet als in der älteren Forschung.[133]
Friedrich trat kein leichtes Erbe an. Er regierte zu Beginn nur einen Teil der habsburgischen Erblande und die Landstände rangen ihm erhebliche Zugeständnisse ab; Friedrich nahm dies hin, da er die Regierung im Reich antreten musste.[134] Dort türmten sich seit Jahren die Probleme. Neben den strukturellen Defiziten des Königtums mit einer sehr beschränkten finanziellen Grundlage, kamen äußere Faktoren hinzu, die sich teils mit den innerfamiliären Konflikten im Hause Habsburg überschnitten.[135] So trat in Ungarn als Konkurrent der polnische König Władysław III. auf, der Albrechts nachgeborenen Sohn Ladislaus Postumus, für den Friedrich nun (nach Konflikten mit Albrecht VI.) als Vormund fungierte, die Krone streitig machte. Dieser fiel zwar 1444 im Kampf gegen die Türken, aber bald darauf kam es zum Konflikt zwischen Friedrich und dem ungarischen Reichsverweser Johann Hunyadi. Beide näherten sich 1450 vertraglich an, doch der Tod von Ladislaus Postumus im Jahr 1457 (ein Jahr nach dem Tod Hunyadis) beendete die habsburgisch-ungarische Personalunion. In der Folgezeit sollte es zu militärischen Auseinandersetzungen zwischen Friedrich und dem neuen ungarischen König Matthias Corvinus kommen, der zeitweise weite Teile der habsburgischen Erblande erobern konnte und sogar von 1485 bis zu seinem Tod 1490 von Wien aus regierte.[136] Militärisch erwies sich Friedrich hier als schwach, zumal er nicht auf Reichsaufgebote zählen konnte. Ähnlich erfolglos wirkte sich das Bündnis Friedrichs mit der Stadt Zürich aus, das er 1442 abschloss und ihn so in den bis 1450 tobenden alten Zürichkrieg gegen die in habsburgisches Gebiet expandierende Alte Eidgenossenschaft verwickelte.[137] Die Eidgenossenschaft ging insgesamt gestärkt aus dem Konflikt hervor und sollte über die nächsten Jahre die Reichspolitik insofern beeinflussen, als dass sie Reichsinteressen im Westen tangierte.

Davon war besonders das Verhältnis zwischen Friedrich und Burgund betroffen. Dort regierte seit dem 14. Jahrhundert eine Nebenlinie des französischen Königshauses, doch betrieb dieses Haus Burgund eine sehr eigenständige Politik und stand zeitweise sogar im Bündnis mit England. Eine herausragende Herrschergestalt war in diesem Zusammenhang Karl der Kühne, von 1467 bis 1477 Herzog von Burgund.[138] Er förderte die höfische Kultur und war gleichzeitig militärisch und politisch sehr aktiv. So erweiterte er den burgundischen Herrschaftskomplex ganz erheblich, der nun mit die reichsten Gebiete Europas umfasste, vor allem die wirtschaftlich leistungsstarken und bevölkerungsreichen burgundischen Niederlande.[139] Problematisch war für Karl allerdings, dass sein Herrschaftskomplex territorial recht zersplittert war und er lehnsrechtlich teils dem König von Frankreich, teils dem römisch-deutschen König verpflichtet war. Der Burgunderherzog strebte daher im Zusammenspiel mit Friedrich die Schaffung eines neuen Königreich Burgunds an, dessen Krone er tragen und so seinen Spielraum zwischen Frankreich und dem Imperium nutzen wollte, zumal sich das Verhältnis Karl zum französischen König Ludwig XI. als sehr angespannt erwies und bisweilen in militärische Auseinandersetzungen gipfelte.[140] Ende 1473 kam es in Trier zum Treffen Karls mit Friedrich, bei dem die Schaffung einer burgundischen Königswürde durch den Kaiser erörtert wurde, was Karl zusätzliche Legitimation verschafft hätte. Doch die kurfürstliche Zustimmung für die Standeserhöhung des Burgunderherzogs war unerreichbar. Friedrich war offenbar ebenso nicht davon überzeugt, dass ihm dies ausreichend nützen würde, wenngleich beide die Eidgenossen als gemeinsamer Feind verband. Dennoch brach der Kaiser die Verhandlungen schließlich formlos ab, was wohl auch an erweiterten Forderungen Karls lag, die Friedrich nicht bereit war zu erfüllen.[141]

Im Januar 1477 fiel Karl im Kampf gegen die Eidgenossen, so dass sich Friedrich nun unverhofft eine einmalige Gelegenheit bot: Das burgundische Erbe für das Haus Habsburg zu sichern. Karls Tochter Maria von Burgund, seit 1475 mit Maximilian verlobt, erbte die burgundischen Besitzungen, doch stand sie im Inneren durch oppositionelle Gruppen (die Generalstände, die ihr das große Privileg abrangen) und von außen durch Ludwig XI. von Frankreich unter Druck, zumal es fraglich war, ob Maria als Frau die Nachfolge in allen Lehnsgebieten antreten konnte.[142] Maximilian reiste im Sommer 1477 in die burgundischen Niederlande, wo er am 19. August 1477 Maria heiratete. Um das reiche burgundische Erbe entbrannte nun ein militärischer Konflikt mit Frankreich, der sich noch über Jahre hinzog (Burgundischer Erbfolgekrieg (1477–1493)) und den habsburgisch-französischen Gegensatz begründete, der bis in die Frühe Neuzeit andauern sollte. Wenngleich Maximilian nach dem Tod Marias 1482 nicht den gesamten burgundischen Herrschaftskomplex für seinen Sohn Philipp den Schönen halten konnte und seine Burgundpolitik auch mit Rückschlägen verbunden war (wobei Friedrich III. ihm 1488 mit einem Heer zur Hilfe eilte), so umfasste der verbliebene Teil doch die reichsten Gebiete.[143] Philipps Heirat mit Johanna von Kastilien 1504 verband den habsburgischen Hausmachtkomplex mit den spanischen Besitzungen in Übersee zu einer neuen europäischen Großmacht. Damit begann eine neue Phase europäischer Politik, die in den Kriegen um die Hegemonie in Europa zwischen Habsburg und Frankreich mündete.[144]
Ein zentrales Ziel Friedrichs war die Kaiserkrönung, weshalb er sich in kirchlichen Fragen 1447/48 mit Papst Nikolaus V. verständigte (Wiener Konkordat). Anfang 1452 brach der König dann nach Italien auf, wo er im März 1452 als letzter römisch-deutscher Herrscher vom Papst selbst in Rom gekrönt werden sollte.[145] Damit hatte Friedrich die Grundlage dafür geschaffen, seinem einzigen Sohn Maximilian 1486 die römisch-deutsche Königswürde zu verschaffen, was einen beachtlichen Erfolg darstellte. Ein zweiter Romzug sollte 1468/69 folgen und hatte eher den Charakter einer Pilgerreise. In Reichsitalien selbst griff der Kaiser kaum ein, wobei er die usurpierte Herrschaft Francesco I. Sforzas in Mailand (immerhin ein wichtiges Reichslehen) faktisch hinnehmen musste, da dessen Stellung sich als zu stark erwies; dies zeigte der Friede von Lodi 1454, womit sich in Italien ein Machtgleichgewicht etablierte, das bis 1494 andauern sollte.[146] Auch im Hinblick auf die Abwehr der Türken blieb Friedrichs Politik weitgehend ambitionslos, obwohl im Mai 1453 Konstantinopel gefallen war und die Ungarn 1456 nur mit Mühe Belgrad halten konnten.[147] Bemerkenswert ist aber etwa der Aufruf Friedrichs III. an die Eidgenossenschaft im Jahr 1455, Hilfe gegen die Türken zu leisten, wobei er sich auf den Schutz der „teutschen Nation“ beruft. Dies stellt jedoch keineswegs etwa einen Beleg für einen aufkommenden „Nationalismus“ im Reich dar, sondern steht im Zusammenhang mit einer antitürkischen Kreuzzugspropaganda.[148]
Von 1444 bis 1471 hielt sich Friedrich nicht mehr im eigentlichen Binnenreich, also dem engeren Reichsgebiet, auf und zog sich weitgehend in die verbliebenen habsburgischen Erblande zurück, wobei er die Reichspolitik aus der Ferne versuchte zu lenken. Dies resultierte vor allem aus der Vielzahl an Konflikten, mit denen sich Friedrich konfrontiert sah.[149] Neben den Problemen innerhalb der Habsburger und mit Ungarn kamen Konflikte um Böhmen hinzu, wo ab 1458 zunächst Georg von Podiebrad, später dann Matthias Corvinus herrschten und jede Umsetzung habsburgischer Ansprüche zunächst unmöglich machte. Hinzu kamen schließlich die Probleme im Westen, zunächst mit der Eidgenossenschaft und anschließend die „Burgundfrage“. Friedrich III. fehlten oft schlicht die Mittel bzw. die notwendigen Herrschaftsinstrumente, um kraftvoller agieren zu können, so dass er meistens nur reagieren konnte. Andererseits war er keineswegs nur passiv tätig: „Das Verdikt der älteren Forschung wurde grundlegend revidiert. Auf der Basis des zunehmend erschlossenen Quellenmaterials kam man zu dem Schluss, dass Friedrich III. wie kein anderer seiner Vorgänger durch Mandate und Diplome in die Politik des Reiches eingegriffen habe.“[150] Die Schaffung von politischen Netzwerken sollte sich später noch als nützlich erweisen, auch im Hinblick auf spätere Reformansätze im Reich wird Friedrich inzwischen positiver bewertet.[151]
Nach dem Tod Albrechts VI. 1463 übte Friedrich die Herrschaft über einen Großteil der habsburgischen Erblande alleine aus, bevor sie sich 1490 vollständig unter seiner Kontrolle befanden. Ab 1470 engagierte sich der Kaiser auch wieder stärker auf der Reichsebene, im Inneren wurden die Hofverwaltung erheblich ausgebaut und die Kanzlei in eine römische und eine erbländische Kammer aufgeteilt.[152] Nachdem Matthias Corvinus gestorben war, hatte Friedrich den Krieg gegen Ungarn wiederaufgenommen und war militärisch nicht ohne Erfolge geblieben.[153] Die Reichsstände verlangten aber für ihre weitere Unterstützung eine Reichsreform und damit einhergehend königliche Zugeständnisse, wozu Maximilian, nicht aber Friedrich bereit war. Im Jahr 1491 wurde aber Frieden mit Ungarn geschlossen, wobei die Habsburger ihre Ansprüche auf Ungarn nicht aufgaben und sich zukünftig noch Hoffnung auf die Stephanskrone machen konnten.[154] Der Gesundheitszustand Friedrichs verschlechterte sich 1492 dramatisch, er starb schließlich am 19. August 1493. Maximilian trat somit die Nachfolge an, sah sich aber mit zahlreichen innen- und außenpolitischen Problemen konfrontiert.[155]

Im Hinblick auf eine dringende Reichsreform kam es nur zu kleinen Fortschritten. Sigismund war mit seinen Versuchen einer Reichsreform gescheitert, doch stand das Vorhaben weiterhin im Raum und wurde in gelehrten Kreisen eingehend diskutiert.[156] Ein entscheidender Punkt war die Teilhabe der Großen und speziell der Kurfürsten an der Reichsgewalt; es wurde erwartet, dass der König wichtige Entscheidungen der Reichspolitik im konsensualen Rahmen mit Rat und Zustimmung Fürsten traf, wobei das kooperative Kurkollegium eine wichtige Rolle spielte. Gleichzeitig waren die königlichen Herrschaftsinstrumente, vor allem aufgrund der geringen finanziellen Mittel (gerade) im 15. Jahrhundert, sehr eingeschränkt. Auf der Reichsebene gewannen nun statt der vom König dominierten Hoftage die Reichstage zunehmend an Bedeutung, wo die Reichsstände (mit einer erhöhten Teilnehmerzahl) ihre Interessen vertreten konnten und der König seinen politischen Spielraum nutzen musste.[157] Im Zentrum der Reichsreform stand die Landfriedenspolitik, die Reform des Gerichtswesens sowie der Finanz- und Kriegsverfassung. Friedrich III. lehnte in seiner Regierungszeit aber alle Vorschläge ab, die Zugeständnisse in der königlichen Herrschaftspolitik mit finanziellen und militärischen Gegenleistungen des Reichstags vorsahen, so dass erst nach seinem Tod Maximilian auf dem Reichstag zu Worms (1495) einlenkte (Reichskammergericht und Ewiger Landfrieden), wenngleich auch damit nicht alle Probleme behoben wurden. Die Reichsreform an sich wurde daher nur ansatzweise verwirklicht, zumal es nicht gelang, eine allgemeine Reichssteuer (gemeiner Pfennig) durchzusetzen, da die Steuereintreibung scheiterte.[158] Das grundlegende Strukturdefizit des Reiches, mit einer fehlenden administrativen Durchdringung auf der Reichsebene und keiner ausreichenden finanziellen Grundlage, konnte nicht behoben werden. Das Zeitfenster für eine Reichsreform schloss sich wieder, wenngleich der Kerngedanke der königlich-ständischen Kooperation in der Reichsregierung bestehen blieb und Modellcharakter für das frühneuzeitliche Reich haben sollte.[159]
König und Reich
Konsensuale Königsherrschaft und Rechtsprechung
- Konsens als Herrschaftsinstrument

Das spätmittelalterliche römisch-deutsche Reich – bestehend aus den drei Reichsteilen Deutschland, Reichsitalien und Burgund (Arelat) – stellte eine Wahlmonarchie dar.[160] Im späten 13. Jahrhundert hatte sich das Kollegium der Kurfürsten endgültig als exklusives Gremium für die Königswahl herausgebildet. Es handelte sich dabei um den Erzbischof von Mainz als Reichserzkanzler für Deutschland, den Erzbischof von Köln als Reichserzkanzler für Italien, den Erzbischof von Trier als Reichserzkanzler für Burgund sowie um vier weltliche Fürsten: den König von Böhmen als Erzmundschenk, den Pfalzgraf bei Rhein als Erztruchsess, den Herzog von Sachsen als Erzmarschall und den Markgraf von Brandenburg als Erzkämmerer.[161] Im Konflikt Ludwigs IV. mit der päpstlichen Kurie hatten die Kurfürsten den Anspruch auf päpstliche Approbation der Königswahl strikt abgewiesen und klar betont, dass nur ihre Wahl ausschlaggebend war und diese keiner weiteren Zustimmung oder päpstlichen Mitwirkung bedurfte (siehe Kurverein von Rhense 1338). Dieser Standpunkte resultierte nicht zuletzt aus dem kurfürstlichen Selbstverständnis und der Wahrung eigener Interessen. Es bezeugt aber auch den verstärkt kooperativen Charakter des Kurfürstenkollegiums im 14. Jahrhundert, ebenso ist die Goldene Bulle von 1356 (dem Reichsgrundgesetz) und die Absetzung Wenzels 1400 Ausdruck dieses Selbstverständnisses (siehe auch die Ausführungen oben zu diesen Ereignissen).[162] Die Kurfürsten verfügten aber nicht nur über das nun exklusive Königswahlrecht, sondern erhoben ebenfalls den Anspruch, direkt in die Reichsherrschaft eingebunden zu werden und maßgeblich politische Mitverantwortung zu tragen. Bei der Ausübung der Königsherrschaft war es daher von Bedeutung, ob der König eine möglichst konsensuale Herrschaftspraxis ausübte und die großen Häuser bzw. die Kurfürsten darin einband oder vor allem die eigenen Interessen verfolgte und damit eine Konfrontation riskierte. Das Einvernehmen zwischen König und den Großen des Reiches war bereits im Hochmittelalter wichtiger Bestandteil königlicher Herrschaft gewesen, dieses Element gewann im Spätmittelalter aufgrund der relativ schwachen Stellung des römisch-deutschen Königtums aber zusätzlich an Gewicht und wurde ein Kernaspekt der spätmittelalterlichen Königsherrschaft.[163]

Man wird den Kurfürsten nicht unterstellen können, sie hätten aus Eigennutz die Reichsinteressen völlig ignoriert. Sie erwarteten von einem zukünftigen König durchaus, dass dieser Reichsinteressen und Reichsrechte wahrte und nicht leichtfertig veräußerte, wie die Absetzung Wenzels 1400 belegt, wo dieser Punkt eine wichtige Rolle spielte (siehe oben). Entscheidend war daher das Zusammenspiel von König und Kurfürsten, wobei freilich jede Seite unterschiedliche Interessen hatte und die eigenen Spielräume versuchte zu nutzen. Die Goldene Bulle von 1356 verdeutlicht das geradezu, da Königtum und Kurfürsten gemeinsam wirkten und unter anderem die endgültige Gruppe der Wähler, Wahlmodalitäten und nicht zuletzt das Mehrheitsprinzip verbindlich regelten.[164] Ihre verfassungsgeschichtliche Wirkung entfaltete die Bulle allerdings erst im Laufe der Zeit, so bei der Absetzung Wenzels, bei der die (rheinischen) Kurfürsten ihr Recht auf Absetzung aus dem königlichen Anforderungskatalog ableiteten und entsprechend Wenzel schwere Versäumnisse vorwarfen.[165]
Im Spätmittelalter gewannen außerdem die Landesherren, die im Kontext des Lehnswesens eine tragende Rolle spielten (siehe unten), weiter an Einfluss und agierten auch im Rahmen der Reichspolitik.[166] In den Territorien und den großen Städten vollzog sich der von Peter Moraw, einem der bedeutendsten deutschen Spätmittelalterforscher, so bezeichnete staatliche Verdichtungsprozess mit erweiterten Verwaltungsstrukturen,[167] ein Prozess, der unabhängig von der Reichsebene geschah. Am Ausgang des Spätmittelalters verwies die gestiegene Bedeutung des Reichstags (Reichstagsakten) mit der erweiterten Vertretung der Reichsstände bereits auf die Entwicklung im frühneuzeitlichen Reich.[168] In diesem Sinne erfolgte eine „Verdichtung“ des Reichs an der Wende zur Neuzeit, so dass Institutionen gestärkt wurden und es einen Professionalisierungsschub auf der Ebene des beratenden Personals gab. Der Reichstag wurde so neben dem Kaiserhof „das zweite Hauptforum der politischen Existenz im Reich“.[169] Entscheidend hierbei war, dass diese Entwicklung einerseits den realen Machtverhältnissen besser entsprach als manch anderer Reformansatz und gleichzeitig ein kooperatives Agieren erforderte – zumal der Weg des Reiches von der „offenen Verfassung“ zur einigermaßen gestalteten Verdichtung mit etablierten Institutionen (wie dem Reichstag und neu dem Reichskammergericht) keineswegs selbstverständlich gewesen ist.[170]
- Recht und Königsherrschaft

Goldene Bulle, der Landfrieden von 1495 und das Reichskammergericht bilden die Eckpfeiler der zentralen Gesetzgebungsprozesse im spätmittelalterlichen Reich. Dies ist von besonderer Relevanz, da Gesetzgebung gerade in vormoderner Zeit ein wichtiges Herrschaftsinstrument darstellte und der Herrschaftsintensivierung diente: Gesetzgebung war gleichzeitig Träger und Ausdruck von Herrschaft.[171] Im römisch-deutschen Reich mussten fürstliche Vorrechte berücksichtigt werden, die seit den Privilegien Confoederatio cum principibus ecclesiasticis (1220) und Statutum in favorem principum (1231/32) galten.[172] Der König hatte das Recht zu wahren, weshalb etwa eine Privilegienvergabe bestimmten Regeln folgte und für den Empfänger Rechtssicherheit bedeutete; der König war durch „Rechtsschranken“ im Spätmittelalter stärker als zuvor gebunden.[173] Wenngleich sich die spätmittelalterlichen Kaiser weiterhin grundsätzlich auf ihre besondere Machtstellung beriefen, so war die „Verfassungswirklichkeit“ doch eine andere. Die rechtssetzenden Kompetenzen entbanden den König oder Kaiser nicht von der Beachtung bestimmter Reglements.[174]
Sogar die Vorstellung, dass der König als oberster Lehnsherr auch höchster Richter war, wandelte sich im Spätmittelalter.[175] Aufgrund neuer Anforderungen im 14. und 15. Jahrhundert veränderte sich die Königsgerichtsbarkeit, so wurden erstmals Appellationen vorgetragen.[176] 1451 wurde das alte königliche Hofgericht durch das königliche Kammergericht ersetzte, das wiederum 1495 durch das Reichskammergericht ersetzt wurde.[177] Diese Entwicklungen führten Bernhard Diestelkamp zufolge dazu, dass das „Heilige Römische Reich sich zum Justizstaat ausbildete, bei dem die Gerichtsbarkeit zum wirkungsvollen Bindemittel für das sonst stark zentrifugale Reich wurde.“[178]
Die Vorstellung wiederum, der Kaiser sei princeps legibus solutus est (von den Gesetzen losgelöst, rezipiert aus dem antiken Kaiserrecht), galt ebenfalls nur sehr bedingt und konnte mit dem gelebten Reichsrecht kollidieren. Die aus dem Kaiserrecht abgeleitete Machtvollkommenheit war daher realpolitisch nicht umsetzbar, wenngleich die spätmittelalterlichen römisch-deutschen Könige prinzipiell daran festhielten.[179] So etablierte sich im Spätmittelalter in den Territorien eine landesherrliche Gesetzgebung, die den Interessen der Landesherren nützte. Die römisch-deutschen Könige konnten die Gesetzgebung nicht zur Verdichtung der Königsherrschaft benutzen, anders als der französische König. Dieser nutzte das Recht gezielt zum Ausbau einer zentralen Königsherrschaft (siehe die Ausführungen unten zu Frankreich).
Grundstrukturen und Probleme der spätmittelalterlichen Königsherrschaft
Im Vergleich mit England und Frankreich war die Grundlage des spätmittelalterlichen römisch-deutschen Königtums eher prekär.[180] Da das Reichsgut bereits während des Interregnums[181] immer mehr geschwunden war, wurde nun die Hausmacht, also der persönliche territoriale Besitz des jeweiligen Königs, zur Grundlage der realen Königsmacht. Die materielle Substanz und die Herrschaftsinstrumente des römisch-deutschen Königtums erwiesen sich im Spätmittelalter als unzureichend, was zuvor nicht der Fall gewesen war. Nun jedoch waren Burgen, Höfe, Dörfer, Gebiete, Städte oder bestimmte Rechte gegen eine feste Summe verpfändet. So konnten kurzfristige finanzielle Engpässe des Königs zwar überwunden werden, langfristig jedoch war dies mit erheblichen Nachteilen verbunden, da die dort gewonnenen Einnahmen bis zur Auslösung entfielen. Insgesamt ist ein erheblicher Substanzverlust feststellbar, vor allem im 14. Jahrhundert und speziell in der Regierungszeit Ludwigs des Bayern und dann Karls IV.: „Für Ludwig den Bayern wurden 110 Verpfändungen reichsstädtischer Herrschaftsrechte gezählt und für Karl IV. rund 90 solcher Pfandbriefe.“[182] Eine Reichspfandschaft stellte grundsätzlich ein absolut übliches Mittel königlicher Herrschaftspolitik dar, problematisch wurde jedoch die systematisch begründete Verpfändungspolitik Karls IV. Diese war nicht zuletzt politisch motiviert und diente unter anderem der Belohnung königlicher Anhänger sowie dynastischen Interessen.[183] Dies gilt etwa für den Erwerb der Mark Brandenburg (1373)[184] oder der Sicherung der Königswahl für Wenzel. Niemand sollte mehr in der Lage sein, im Reich Politik gegen die Interessen des Hauses Luxemburg zu betreiben. Diese Konzeption eines „hegemonialen Königtums“, das sich ganz auf die eigene Hausmacht stützte, war jedoch insofern problematisch, wenn der König keinen Zugriff darauf hatte, wie die Zeit danach zeigen sollte: Ruprecht von der Pfalz und anschließend Sigismund verfügten, wie oben bereits geschildert, im deutschen Reichsteil über keine nennenswerte Hausmacht mehr.

Die unzureichenden finanziellen Grundlagen erwiesen sich letztlich als ein entscheidendes Defizit des römisch-deutschen Königtums im Spätmittelalter. In finanzieller Hinsicht stellte sich die Lage des Königtums im 15. Jahrhundert dann noch einmal als besonders prekär heraus. Karl IV. soll über jährliche Einkünfte in durchschnittlicher Höhe von ca. 164.000 Florin verfügt haben bzw. über eine Mindestsumme von ca. 40.000 Florin. Ruprecht von der Pfalz, der selbst ebenfalls Reichsgut verpfändete, hingegen verfügte über durchschnittlich nur noch rund 17.500 Florin. Ruprechts Nachfolger Sigismund verfügte über rund 13.000 Florin.[185] Die durchschnittlichen Einkünfte hatten sich im 14. Jahrhundert wohl ungefähr auf 100.000 Florin und 75.000 Mark Silber belaufen, dies ist zumindest annäherungsweise der tatsächliche Wert der Verpfändungen der Reichsstädte im 14. Jahrhundert.[186] Im Gegensatz zu Frankreich und England existierte im Reich zudem weder eine Zentralkasse noch eine Finanzverwaltung, die in Westeuropa längst etabliert war. Das Fehlen derartiger Institutionen erwies sich im römisch-deutschen Reich als schwerwiegendes Defizit, doch fehlte selbst ein Gesamtverzeichnis des Reichsguts; ohne Bestandsverzeichnisse war aber der Aufbau einer effektiven Finanzverwaltung kaum möglich und die schwankenden Reichseinnahmen wurden so mangelhaft verwaltet.
Während der Handlungsspielraum des Königtums durch das politische Gefüge des Reichs grundsätzlich recht stark beschränkt war und im Gegensatz zu den westeuropäischen Monarchien nur wenige regelmäßige Einkünfte zur Verfügung standen (wie Steuereinnahmen und Regalien, deren Erträge oft eher zu gering waren), war die Königsherrschaft gleichzeitig von einer strukturell bedingten Überforderung geprägt. Zentrale königliche Aufgabenfelder waren die Rechts- und Friedenswahrung, weshalb die königliche Landfriedenspolitik[187] und die Sicherstellung der hohen Gerichtsbarkeit eine wichtige Rolle spielte.[188] Im administrativen Bereich konnte sich das römisch-deutsche Königtum nur auf rudimentär vorhandene Strukturen stützen.[189] Der König verfügte an seinem (oft noch immer reisenden) Hof zwar über eine Kanzlei, die allerdings bis ins frühe 15. Jahrhundert keine unabhängig von Herrscherwechseln kontinuierlich arbeitende Reichskanzlei mit angeschlossenem Archiv war. Erst seit dem Übergang Ruprechts von der Pfalz auf Sigismund ist eine gewisse verwaltungstechnische Kontinuität gegeben gewesen. Die Kanzlei Ruprechts war vorbildlich geführt, nach seinem Tod wurden Register und teilweise auch Kanzleipersonal von Sigismund übernommen.[190] Besonders im 15. Jahrhundert nimmt die Masse an verfügbaren Quellen erheblich an, speziell im Hinblick auf Urkunden, Akten und anderem Schriftgut. Dies ist verbunden mit der gestiegenen Bedeutung der schriftlichen Verwaltung und zeigt sich unter anderem in der zunehmenden Professionalisierung des oft juristisch gebildeten Kanzleipersonals. 1433 ist mit Kaspar Schlick zudem der erste Laie an der Spitze der königlichen Kanzlei belegt.
Im Reich existierte auch keine Reichsverwaltung, die flächendeckend auf königliche Amtsträger hätte zurückgreifen können. All dies steht im völligen Gegensatz zur Entwicklung in England und Frankreich, wo bereits relativ frühzeitig weisungsgebundene königliche Amtsträger eingesetzt und kontinuierlich arbeitende königliche Verwaltungsbehörden geschaffen worden waren.[191] Aufgrund der politischen Verhältnisse im Reich, der fehlenden Ressourcen und unzureichenden verwaltungstechnischen Instrumentarien war eine vollständige Herrschaftsdurchdringung nicht und eine Herrschaftsintensivierung kaum möglich. Der moderne Betrachter stellt Peter Moraw zufolge allerdings Ansprüche an das spätmittelalterliche Königtum im Reich, die die Könige nicht erfüllen konnten: Sie waren adlige Herrscher, die nicht zuletzt in dynastischen Bahnen dachten und Reichsinteressen eher untergeordnet betrachteten.[192] Der königliche Einflussbereich war im Spätmittelalter im Wesentlichen auf die Gebiete im Südwesten mit Teilen der Rheinregion beschränkt (die sogenannten königsnahen Regionen), während sich der Norden dem effektiven herrschaftlichen Zugriff bereits seit der späten Stauferzeit faktisch entzog (die königsfernen Regionen); daneben existierten sogenannte königsoffene Regionen.[193]
Das Kaisertum zwischen gesteigerter Königsherrschaft und universalen Weltherrschaftsanspruch

Ein wichtiger Aspekt des römisch-deutschen Königtums stellte die Tradition des Kaisertums und die lange Sinngeschichte des römischen Imperiums dar. Zentraler Ausgangs- und ständiger Bezugspunkt für das mittelalterliche Kaisertum war das antike römische Kaisertum, in dessen Nachfolge sich die mittelalterlichen römisch-deutschen Könige seit dem Frühmittelalter im Rahmen der translatio imperii sahen.[194] Der offizielle lateinische Titel des römisch-deutschen Herrschers lautete während des gesamten Spätmittelalters rex Romanorum („König der Römer“), als Kaiser bezeichnete er sich als Augustus, was man im Spätmittelalter als „Mehrer des Reiches“ übersetzte.[195] Die römisch-deutschen Könige wurden zwar erst durch die päpstliche Krönung zu Kaisern, dennoch legten sie sehr viel Wert auf die Trennung der beiden Universalgewalten. Das Kaisertum war zudem älter als die Kirche, was die spätmittelalterlichen Kaiser durch ihren Weihnachtsdienst (der Lesung aus dem Lukasevangelium)[196] implizit betonten, regierte der erste Kaiser Augustus doch schon vor der Geburt von Jesus. Auch ansonsten verwahrten sich die Kaiser dagegen, dem Papst untergeordnet zu sein, denn zumindest in der Theorie beinhaltete die universale Reichsidee den Anspruch auf kaiserliche Weltherrschaft.[197] Im 14. Jahrhundert verwischte zunehmend die Unterscheidung zwischen Regnum (Königreich) und Imperium, auch die deutsche Bezeichnung Reich deckte nun beides ab.[198]
Der Universalherrschaftsanspruch resultierte aus der langen Sinngeschichte des Kaisertums, in die zahlreiche Elemente eingeflossen waren, wobei bereits das spätantike römische Kaisertum den Universalanspruch christlich akzentuiert hatte. Trotz der Erschütterungen der sakralen kaiserlichen Aura im Rahmen des Investiturstreits hatten auch die nachfolgenden Kaiser grundsätzlich an dem universalen Charakter des Kaisertums festgehalten, das spätmittelalterliche Königtum verfügte zudem immer noch über eine sakrale Komponente.[199] Das Kaisertum galt im Spätmittelalter weiterhin als höchste Stufe weltlicher Herrschaft, der Kaiser zumindest theoretisch als über allen anderen weltlichen Herrschern der lateinischen Christenheit stehend.[200] Dies hatte Heinrich VII. bei seiner Kaiserkrönung im Juni 1312 explizit betont, als er nach der ersten Kaiserkrönung seit 1220 verkünden ließ, dass, so wie Gott über alle himmlischen Heerscharen gebiete, auch alle Herrscher der Welt dem Kaiser unterstehen würden, was Widerspruch seitens des französischen Königs ausgelöst hatte.[201] Diese Ansprüche waren nicht neu, vielmehr wurden sie nur zu einer Zeit artikuliert, als man bereits das Kaisertum als Institution für weitgehend erledigt gehalten hatte.[202] Die Aufgabe der Umsetzung des theoretischen Universalanspruchs stellte sich in der politischen Praxis aber auch gar nicht. Das Kaisertum bewegte sich vielmehr stets im Spannungsfeld von gedachter Universalordnung und realer politischer Gestaltungskraft.[203] In diesem Sinne war es realpolitisch zwar nur eine „gesteigerte Königsherrschaft“,[204] die aber auf einem alten und sehr langlebigen ideengeschichtlichen Fundament beruhte, so dass diese Idee noch bis in die Frühe Neuzeit bei Karl V. nachwirkte.[205]
Städte und Landesherrschaften
Die „deutschen Lande“ im Spätmittelalter
Das römisch-deutsche Reich war ein dezentral organisierter Herrschaftsverbund bestehend aus Städten und Territorien mit geistlichen und weltlichen Landesherrn.[206] In „der Mitte Europas ist der moderne Staat im Territorium, in der Landesherrschaft“,[207] entstanden, gleichzeitig „ist unser Bild von der mittelalterlichen Stadt ganz entscheidend vom Spätmittelalter geprägt“.[208] Dort vollzog sich eine politische und wirtschaftliche Institutionalisierung, die unabhängig von der Reichsebene verlief und die nachfolgende deutsche Geschichte maßgeblich geprägt hat. Dennoch stellte das Reich einen Flickenteppich von Territorien dar und die Entwicklung dessen, was man als moderne Staatlichkeit betrachten würde, war auch am Ausgang des Spätmittelalters noch nicht abgeschlossen.[209] Im ausgehenden Spätmittelalter wurde versucht, die politische Zersplitterung der Städte und Landesherrschaften durch die Einrichtung der Reichskreise etwas zu ordnen.
In den „deutschen Landen“ hielt man am vorstaatlichen Reichsgedanken fest.[210] Der Begriff deutsche Lande kommt im Spätmittelalter auf, bevor er in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts von der Bezeichnung Teutsche Nation überlagert wird, woraus sich aber keine stärkere innere Verfestigung ablesen lässt.[211] Die Entwicklung eines deutschen Eigenbewusstseins setzte erst langsam ein, als sich deutsche Gelehrte wie Alexander von Roes und Lupold von Bebenburg Gedanken über die Rolle „der Deutschen“ im Gefüge Europas und einer politischen Identität machten, was aus einer Position politischer Schwäche des Reiches geschah. Diese Überlegungen blieben aber weiterhin stark mit der universalen Reichsidee verknüpft.[212]
Die Quellenlage erlaubt hinsichtlich der Bevölkerungszahl nur ungefähre Schätzungen. Für Europa wird für die Zeit um 1300 von ca. 70 Millionen Einwohnern ausgegangen,[213] wobei Hungersnöte und Seuchen (wie die große Pest Mitte des 14. Jahrhunderts) dann für einen deutlichen Bevölkerungsrückgang bis um 1400 sorgten.[214] Für 1500 reichen die Schätzungen von 50 bis 84 Millionen Einwohnern.[215] Im deutschen Reichsteil (also ohne Oberitalien und Burgund) lebten um 1300 geschätzt 12 bis 15 Millionen Menschen,[216] um 1500 waren es etwa 16 Millionen.[217]
Die Städte
Städte spielten im Spätmittelalter eine wichtige Rolle, besonders als Wirtschafts- und Kulturzentren, wobei neben alten urbanen Siedlungen neue Städtegründungen hinzu kamen.[218] Zu unterscheiden ist hierbei neben den Territorialstädten/Landstädten (die Landesherren unterstanden) zwischen den Reichsstädten, die dem Kaiser direkt unterstanden (Reichsunmittelbarkeit), und freien Städte.[219] Letztere hatten sich ihre politische und rechtliche Autonomie von ihren vorherigen (zumeist geistlichen) Oberherren erkämpft, da viele Städte ursprünglich Bischofsstädte waren. Sie beanspruchten weitgehende Unabhängigkeit vom König, mit wenigen Ausnahmeregelungen; einige zuvor freie Städte gerieten im Laufe der Zeit sogar wieder unter die Herrschaft von Landesherren. Die meisten Städte zählten denn auch zu den Territorialstädten.[220]

Mit der steigenden Bedeutung der Städte während des Hochmittelalters bildeten sich städtische Gemeinden, die dann in oft harten Auseinandersetzungen ihre politische Selbstverwaltung erstritten und diese auch rechtlich verbrieft bekamen.[221] Teilweise wurden Rechte der Landesherren, die in Geldnot waren, auch nur vom Stadtrat aufgekauft. Im Spätmittelalter erfolgte dann ein Schub in der Institutionalisierung,[222] indem die Bedeutung des Stadtrats[223] im politischen und der Zunft[224] im wirtschaftlichen Bereich zunahm. Der jeweilige Stadtherr war vor allem im Hinblick auf Verwaltung, Gesetzgebung und Gerichtsbarkeit entscheidend gewesen. Im 13. Jahrhundert trat in den Städten mit schwachen Stadtherren der Rat zunehmend an dessen Stelle, selbst in den Territorialstädten entstanden Ratsverfassungen (da sich dies nicht zwingend gegen den Stadtherren richtete), mit Bürgermeister und beratenden Rat (mit dem Rathaus als Verwaltungs- und Repräsentationsort), wobei die Wahlverfahren auf einen engen Kreis von Kandidaten aus reichen und einflussreichen Familien beschränkt war.[225] Viele Ratssitze, Amts- und Gerichtsposten wurden daher über Generationen von einem verhältnismäßig kleinen Kreis von reichen Familien besetzt, die durch Handel und Grundbesitz zu Vermögen gelangt waren.[226] In diesem Zusammenhang kam es oft zu Auseinandersetzungen zwischen der städtischen Oberschicht, den Patriziern,[227] und dem aufstrebenden Bürgertum (vor allem aus dem Handwerk und Handel). Mitte des 14. Jahrhunderts drängten so neureiche Familien an die städtische Spitze und verdrängten teils die alten Patriziergeschlechter, um nun selbst an deren Stelle zu treten.[228] Ohnehin ist der Bedeutungsgewinn der Städte einschließlich der Erringung ihrer kommunalen Freiheiten eng mit ihrer steigenden wirtschaftlichen Leistungskraft seit dem Hochmittelalter verknüpft.[229] Handel und Gewerbe verlief im Spätmittelalter maßgeblich über die Städte, wobei die größeren von ihnen freilich dominierten: „Die großen Wirtschaftszentren am äußeren Niederrhein, ferner Köln, Lübeck, Nürnberg, dann auch Regensburg, Augsburg, Wien, Metz, Frankfurt am Main, Dortmund, Hamburg, Erfurt, Breslau und Danzig schufen jeweils hegemonial bestimmte Wirtschaftsräume und Verbindungen sowohl untereinander als auch mit anderen europäischen Handelszentren.“[230] Geld- und Kreditwirtschaft wurden immer wichtiger, mit neuen Gold-Silber-Währungen. In den Zünften war der „Mittelstand“ organisiert, die lebenslange Zunftzugehörigkeit war nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sozial und politisch bedeutsam, sowohl intern (Meister, Geselle, Lehrling) als auch zwischen den diversen Zünften gab es ein Gefälle. Die Zünfte waren für die Organisation städtischer Aufgaben wichtig und die Zunftzugehörigkeit gehörte zur Voraussetzung für das Bürgerrecht.[231]

Des Weiteren etablierten sich im Laufe der Zeit verschiedene vom Rat beschlossene Stadtrechte bestehend aus königlichen oder landesherrschaftlichen Privilegien und Einzelrechten.[232] Viele Städte schufen nicht eigene Rechte, sondern übernahmen bereits bestehende. So verfasste Jordan von Boizenburg 1270 das sogenannte Ordeelbook, das älteste Stadtrecht Hamburgs; älter war das Lübische Recht und das Magdeburger Recht. Eingetragene Bürger besaßen damit spezielle Rechte und unterlagen der städtischen Gerichtsbarkeit, wie sich auch das Alltagsleben in den befestigten Städten vom ländlichen Alltag unterschied.[233] In diesem Kontext sind die primär in den Städten lebenden und im Wirtschaftsleben eingebundenen Juden als separate Gruppe zu betrachten, die Mitte des 14. Jahrhunderts unter den Pestpogromen zu leiden hatten und auch im 15. Jahrhundert Verfolgungen ausgesetzt waren.[234]
Um 1400 existierten rund 4.000 Städte im deutschen Reichsteil, wovon die allermeisten weniger als 1.000 Einwohner hatten, rund 200 Städte hatten zwischen 2.000 und 10.000 Einwohner.[235] Um 1500 existierten im Reich rund 45 Großstädte mit über 10.000 Einwohnern.[236] Die größte deutsche Stadt war Köln, wo zu Beginn des 14. Jahrhunderts etwa 35.000 bis 40.000 Menschen lebten, während zur gleichen Zeit die großen reichsitalienischen Metropolen Mailand und Florenz um die 100.000 Einwohner hatten.[237] Unter den größeren Städten spielten verschiedene eine wichtige politische Rolle. Aachen war der traditionelle Ort der Krönung der römisch-deutschen Könige und Kaiser, während Frankfurt am Main oft Ort der Königswahl war. Karl IV. favorisierte die Reichsstadt Nürnberg, die in seiner Regierungszeit kurzzeitig zu einem kaiserlichen Zentralort wurde. Städte waren ebenso wichtige Bildungszentren, wo im 14. Jahrhundert die ersten Universitäten im deutschen Reichsteil entstanden: 1346 in Prag (durch Karl IV. und vorerst eher bescheiden), dann etwa in Heidelberg (1386), Köln (1388), Erfurt (1392) und später mehreren weiteren Städten, wobei einige Gründungen aber nach wenigen Jahren scheiterten.[238]
Vor allem die größeren Städte bewegten sich in einem politischen Spannungsfeld von Königsmacht und Interessen der umliegenden geistlichen und weltlichen Landesherren.[239] Die Zahl der Reichsstädte nahm im 14. Jahrhundert ab, da im Rahmen der Verpfändungspolitik des Königtums mehrere Reichsstädte faktisch dem Zugriff des Königtums entzogen wurden, wovon einige Landesherren profitierten; andererseits erwarben einige Städte selbst umliegendes Territorium.[240] Ebenso kam es im Spätmittelalter wiederholt zu Konflikten von Städten mit Landesherren, weshalb sich regionale und überregionale städtische Bündnisse[241] bildeten (Rheinischer Städtebund in den 1250er Jahren, Schwäbischer Städtebund im 14. Jahrhundert oder als bekanntestes Beispiel die Hanse), um entweder gemeinsame politische und/oder wirtschaftliche Interessen zu wahren.
Der Ausbau der Landesherrschaften

Städte spielten in der Politik verschiedener Landesherren eine wichtige Rolle, teils aufgrund ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, teils als Residenzen und Verwaltungszentren. Gleichzeitig bauten die Landesherren ihre territoriale Verwaltung (Kanzlei, Notariat, Gerichte, Finanzverwaltung und örtliche Amtspersonen) aus und intensivierten so ihre Herrschaft institutionell (Territorialisierung).[242] Oder in den Worten von Peter Moraw: „Die innere Geschichte der deutschen Territorien ist in besonderer Weise die Geschichte der Staatswerdung in Deutschland.“[243] Die Residenzbildung[244] war ein besonders Kennzeichen der spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Landesherrschaft und sorgte dafür, dass sich Verwaltungsstrukturen und hier besonders die Finanzverwaltung verfestigten.[245] Dies ging mit einer zunehmenden Verschriftlichung der Herrschaftsausübung einher, weshalb die Kanzlei immer wichtiger wurde, was sich in der zunehmenden Anzahl überlieferter Dokumente und Amtsbücher widerspiegelt, wobei nun zunehmend in Städten und nicht mehr in Burgen Urkunden ausgestellt wurden. Die Landesherren stützten sich so in zunehmendem Maße auf lokale Amtsträger, wodurch eine Funktionselite entstand.[246]
Die Finanzen waren der Kern fürstlicher Herrschaft, wobei die Entwicklung in den Territorien, verglichen mit der städtischen Finanzverwaltung (in der die Rechnungslegung bereits verbreitet war), verspätet begann. Neben der Grundherrschaft gewannen im Spätmittelalter Steuern an finanzieller Bedeutung. Bisweilen mussten Landesherren ihre Ansprüche innerhalb ihrer Territorien durchsetzen, so bei der Rücknahme verpfändeter Güter, was zu Konflikten führen konnte, wie die Hildesheimer Stiftsfehde von 1519 exemplarisch zeigt.[247] Im Rahmen der Landesherrschaft waren die Landstände (als ständischen Vertretung) durchaus politische Mitspieler, vor allem ab dem 15. Jahrhundert und hier speziell in Steuerfragen.[248] Neben dem Amtsrecht spielte hier das zweite wichtige Herrschaftsinstrument der Landesherrschaft eine Rolle, das Lehnsrecht, da Landesherrschaft neben einer Konzentration von Rechtstiteln auf diesem als zweiter Säule basierte, insofern es Adelige innerhalb des landesherrlichen Territoriums betraf. In diesem Sinne waren landesherrliche Amts- und Lehnsbindungen eng miteinander verknüpft, wobei lehnsrechtliche Bindungen nun in die neue, einem Strukturwandel unterliegende territoriale Organisationsstruktur einbezogen wurden.[249] Das Verhältnis des Landesherren und den Landständen konnte stark variieren, ebenso wie die landständische Erscheinungsform: In manchen Regionen trat etwa ein streitlustiger Adel konkurrierend zum Landesherren auf, in anderen Regionen kooperierten die Landstände; viel hing von der Stellung und Durchsetzungsfähigkeit des Landesherren ab. Hinzu kamen abweichende Interessen der verschiedenen Vertreter (die Territorialstädte, der weltliche Adel und Geistlichkeit), ebenso war der Repräsentationsgedanke unterschiedlich ausgeprägt.[250]
Rund ein Sechstel der Landesherrschaften befand sich in geistlicher Hand, an deren Spitze das Oberhaupt nicht dank Erbnachfolge stand und dessen Besitz nach Kirchenrecht auch nicht veräußert werden konnte; in verwaltungstechnischen Fragen hingegen unterschied die weltliche und geistliche Landesherrschaft kaum etwas.[251] In ihrer Entstehung unterschieden sich die diversen Landesherrschaften, im Kern basierte sie auf der „Bündelung von Einzelrechten in der Hand eines Herrn [...] Jedes Rechtebündel enthielt mehrere der teils eigenrechtlichen, teils vom Königtum abgeleiteten Bestandteile“.[252] Es ist daher eher irreführend, selbst für das Spätmittelalter den Begriff Territorialstaat zu verwenden, da Herrschaft in diesem Kontext immer noch stark auf personale Bindungen basierte.[253] Entstehung und Entfaltung der Landesherrschaft beruhte aber nicht allein auf einer rechtlichen Grundlage, vielmehr spielten politisch-militärische Erfolge bei der Durchsetzung der Landesherrschaft eine zentrale Rolle.[254] Dies schloss ein expansives Vorgehen gegenüber anderen Landesherren oder Städten ein, ebenso bisweilen Konflikte mit dem Königtum. Denn der fürstliche politische Handlungsspielraum war durchaus begrenzt und speiste sich aus fünf Faktoren: Dem geografischen Raum der Akteure, der Ökonomie, der Familie (primär in den weltlichen Herrschaften), der verfassungsrechtlichen Stellung im Reich und dem jeweiligen Rangbewusstsein.[255] Hinzu kam in den weltlichen Territorien eine dynastische Komponente mit teilweise konkurrierenden Erbansprüche, denn die „maßgebende Triebkraft der Territorialgeschichte war die Dynastie“.[256] Das Aussterben diverser Adelsgeschlechter begünstigte daher den territorialen Ausbau der Landesherren, die ihre Ansprüche durchsetzen konnten.

Unter den weltlichen Landesherrschaften stechen einige hervor. Die Hausmachtkomplexe der Kurfürsten, die selbst als Landesherren fungierten, waren unterschiedlich groß und bedeutend. Haus Luxemburg verfügte über die ausgedehntesten Gebiete, nachdem Johann von Luxemburg, der Sohn Heinrichs VII., im Sommer 1310 die böhmische Königskrone erlangte. In der nachfolgenden Zeit wurde die luxemburgische Hausmacht stetig erweitert.[257] Die Besitzungen der „kurpfälzischen“ Wittelsbacher waren unbedeutend, während eine andere Linie das Herzogtum Bayern beherrschte, aber nicht über die Kurstimme verfügte.[258] Zeitweise kontrollierten die Wittelsbacher im 14. Jahrhundert auch die Mark Brandenburg und Tirol, bevor weite Teile wieder verlorengingen und es zu Teilungen des bayerischen Herzogtums kam (wie Straubing-Holland, Bayern-Landshut, Bayern-München). Außerhalb der Kurfürsten traten die anderen größeren Landesherren hervor, so neben den Wittelsbachern vor allem die Habsburger, die im späten 13. Jahrhundert Territorien im Südosten gewannen (die habsburgischen Erblande mit Österreich und der Steiermark).[259] In Thüringen und Meißen etablierte sich das Haus Wettin, das seit dem frühen 15. Jahrhundert außerdem das Kurfürstentum Sachsen regierte. Im Nordwesten waren die Besitzungen der Welfen verglichen mit früherer Zeit deutlich verkleinert, aber immer noch ein Faktor.[260] Im Westen war die politische Lage kompliziert, da dort einige Landesherren sowohl dem römisch-deutschen König als auch dem französischen König für Teile ihrer Territorien huldigen mussten (Doppelvasallität,[261] wie das Herzogtum Bar); das Phänomen tritt aber auch woanders im Reich teils auf.[262] Bedeutsam waren etwa das Herzogtum Lothringen und das Herzogtum Brabant, im Südwesten auch die Grafschaft Württemberg. Der Norden und Nordosten (wie das Herzogtum Pommern[263]) galten als königsferne Gebiete,[264] wo die Landesherren kaum königliche Einmischung befürchten mussten. Einen ausführlichen Überblick zu den diversen weltlichen und geistlichen Akteuren bietet die Datenbank der Forschungsstelle Residenzenforschung (Niedersächsische Akademie der Wissenschaften zu Göttingen).[265]
Ländliche Gesellschaft

Im Spätmittelalter lebte, trotz der Zunahme der städtischen Bevölkerung, die ganz überwiegende Mehrheit der Menschen auf dem Land, in kleineren Siedlungen und Dörfern.[266] Wenngleich die wirtschaftliche Bedeutung der Städte stetig zunahm, nahm die Agrarproduktion immer noch den wichtigsten Platz im Wirtschaftsleben ein. Allerdings spielte sich ebenso ein gravierender sozioökonomischer Wandlungsprozesse ab: Das so lange dominierende System der Grundherrschaft[267] mit einem zentralen Fronhof (Villikation)[268] zerfiel bereits im 11. Jahrhundert; dieser Prozess setzte sich in ganz Europa bis ins beginnende Spätmittelalter fort und führte dazu, dass die großen Güter in kleinere Höfe zerfielen.[269] Dies führte zu Veränderungen für den Bauernstand und die Agrarwirtschaft.[270] Bei der Grundherrschaft handelte es sich prinzipiell nicht nur um ein Wirtschafts-, sondern auch um ein Herrschaftsverhältnis, also um eine sozioökonomische Organisationsform. In diesem System der Agrarverfassung waren die landnehmenden Bauern gegenüber den Landeigentümern unterprivilegiert; Bauern wehrten sich mit Dienst- und Abgabenverweigerung oder drohender Abwanderung, teils wurden kaiserliche und/oder örtliche Schiedsgerichte angerufen.[271] Im Rahmen der neuen Form der Grundherrschaft bewirtschafteten Bauern oft selbstständig die verkleinerten Höfe für die Grundherren und leisteten dafür eine Grundrente in Natural- oder Geldleistungen.[272] Der zur Verfügung gestellte Grund wurde nun also von ihnen in eigener Verantwortung bearbeitet und wirtschaftlich für eine bestimmte Abgabe genutzt, war aber nicht ihr Eigentum. In diesem Sinne änderte sich zunächst nur die Bewirtschaftungsform, nicht das grundlegende Besitzverhältnis, das sich im Urbar widerspiegelte; eine der wichtigsten spätmittelalterlichen Quellen stellt in diesem Zusammenhang das Landbuch Karls IV. dar.

Im Laufe der Zeit verbesserte sich aber die Stellung der Bauern, da die Leih- oder Pachtabgaben zunehmend in festen Beträgen geleistet wurden, was sich zuungunsten des Grundherren auswirken konnte, und des Weiteren Bauern teils über Untereigentum am bebauten Land verfügen konnten.[273] Denn die Zeitleihe entwickelte sich zu einer „Bodenvergabe mit Zwischen- und Sonderformen von der Besitzübertragung gegen Abgaben bis hin zu regelrechten Pachtformen mit unterschiedlichen Laufzeiten“.[274] Dies schuf neue Rechtsformen, die Sozial- und Wirtschaftsstruktur lockerte sich auf, da Menschen leichter dorthin abwandern konnten, wo sich ihnen neue Chancen boten (Peter Moraw nannte dies einen „sozialen Markt für Menschen“).[275] Die Stellung der zuvor meist unfreien Bauern verbesserte sich so, wenngleich an der Wende zur Neuzeit ihre Rechte von Grundherren wieder beschnitten wurden. Im 15. Jahrhundert ist ein Übergang von (zeitlich begrenzten) Zeit- und Teilpachtverträgen zu Erbpachtverträgen erkennbar.[276] Um 1500 bildete sich dann in weiten Teilen des Reiches die „Rentengrundherrschaft“ heraus, mit der zwingenden Verpflichtungen von Abgabenzahlungen statt Dienstpflichten. In diesem Zusammenhang fand aber oft eine Kopplung eines „guten“ Besitzrechts mit einem „schlechten“ persönlichen Rechtsstatus des Bauern statt, mit teils hoher materieller Belastung der Bauern hinsichtlich der Abgaben.[277] In den Gebieten östlich der Elbe entwickelte sich außerdem das System der Gutsherrschaft, das die Bauern zu zusätzlichen Dienstverpflichtungen zwang und ihre Rechte beschnitt.[278] Dieses Spannungsfeld führte auch zu Bauernaufständen, wovon vor allem der Süden Deutschlands betroffen war, wo sich Gemeindeverfassungen herausgebildet hatten, doch sind die lokalen Bauernunruhen im deutschen Reichsteil quellenmäßig eher schlecht belegt, von vielen wissen wir kaum etwas.[279] Zu den bekannteren Unruhen gehören im 15. Jahrhundert das Auftreten des Paukers von Niklashausen 1476 oder die Bundschuh-Bewegung von 1493; im frühen 16. Jahrhundert brach dann der große Bauernkrieg aus.[280]
Bedeutsam für das ländliche Spätmittelalter ist die sich in einem längeren Prozess stattfindende Ausgestaltung der dörflichen Gemeindeordnung, also der auf dem Lande für Kleinbauern und Tagelöhnern sichtbarsten Form von Herrschaft in einem genossenschaftlichen Gemeindeverband.[281] Dies bestimmte auch das dörfliche Alltagsleben.[282] In den meisten Dörfern dominierte eine meist dünne bäuerliche Oberschicht, die die Dorfgerichtsbarkeit ausübte und oft die größten lokalen Höfe bewirtschaftete. Deren Mitglieder profitierten davon, dass sie amtliche Funktionen für die örtlichen Grund- bzw. Gutsherren ausübten. Ihre größeren Höfe konnten über den Eigenbedarf produzieren, die Waren auf den städtischen Märkten verkaufen (wobei Städte allerdings oft die Preise diktierten) und erzielten so Gewinne. Die Intensität des Handels mit agrarischen Produkten unterschied sich freilich regional und hing nicht zuletzt von den verfügbaren Märkten ab (wichtig waren ebenso Wochen- und Jahrmärkte), nahm aber zwischen ländlicher Region und urbanen Zentren insgesamt zu. Dies trifft auch auf den überregionalen Handel zu, wie etwa mit Getreide.[283] Teilweise wurde der Gewinn der Großbauern als Kredite für kleinere Bauern benutzt und machte diese so finanziell abhängig. Dies führte dazu, dass erfolgreiche Großbauern zwar rechtlich dem niederen Adel untergeordnet waren, dies ökonomisch aber oft nicht der Fall war.[284] Daneben existierte eine relativ breite Bauernschicht, gefolgt von der Masse der Kleinbauern, die um 1300 mehr als die Hälfte der Landbevölkerung ausmachten und sich aus Kleinstelleninhabern, Tagelöhnern und Gesindekräften zusammensetzten, deren Lebensunterhalt sich oft als prekär erwies.[285]

Im Spätmittelalter dominierte die Dreifelderwirtschaft,[286] was eine Intensivierung der Landwirtschaft ermöglichte. Ackerbau, Nutzungssysteme und Verfahren wandelten sich freilich im Laufe der Zeit.[287] Im römisch-deutschen Reich wurden verschiedene Getreidearten angebaut. In Nord- und Mitteldeutschland sowie Bayern dominierte Roggen, das gutes Mehl zum Backen lieferte und leicht zu lagern war. Es war im deutschen Reichsteil so verbreitet, dass es in Italien als deutsches Korn (grano germano) galt; demgegenüber wurde in Südwestdeutschland stärker Dinkel angebaut.[288] Zur eigenen Versorgung bauten Bauern Hülsenfrüchte (Erbsen, Bohnen und Linsen) und Gemüse (wie Kohl, Rüben und Zwiebeln) an, das schließlich auch der steigenden Nachfrage der städtischen Bevölkerung diente.[289] Hinzu kam eine regional unterschiedlich ausgeprägte Viehwirtschaft und Tierhaltung (vor allem Rinder und zur Fleischgewinnung besonders Schweine). Nachdem es vor der Pest eine „Vergetreidung“ der Landwirtschaft gegeben hatte, wurde mit dem anschließenden Bevölkerungsrückgang und den fallenden Getreidepreisen die Viehhaltung wieder lukrativer, wobei Umfang und Intensität schwankten.[290] Die Esskultur im Mittelalter ist ohnehin regional und zeitlich differenziert zu betrachten.
In der gesamten Vormoderne traten immer wieder Hungersnöte und Versorgungsengpässe auf. Im 14. Jahrhundert ereigneten sich ebenso Hungerkrisen, verschlimmernd kamen Seuchen wie die große Pestwelle um 1348 und andere Krankheitswellen hinzu. All dies führte zu einem Rückgang der Bevölkerung, doch sind die Einzelzusammenhänge (Ernährung, Hunger, Krankheiten und Entvölkerung) aufgrund der sehr heterogenen Quellenlage oft unklar; anders als noch die ältere Forschung wird in neuerer Zeit vor voreiligen Herleitungen gewarnt, nur regionale Spezialstudien bieten in diesem Kontext genauere Einblicke.[291] In der Forschung wurden oft strukturelle Probleme betont: So wurde etwa davon ausgegangen, dass die landwirtschaftliche Produktion den Bedarf der steigenden Bevölkerungszahlen nicht mehr adäquat abdecken konnte; es kam zu Getreidemissernten und Viehseuchen, das Resultat war beispielsweise die Hungersnot von 1315–1317. Doch ebenso ist etwa ein Krisenverlauf im 16. Jahrhundert feststellbar.[292] In diesem Zusammenhang sind oft lokale Ereignisse und eine nicht immer befriedigende Quellenlage zu berücksichtigen. Statt der mangelnden Leistungsfähigkeit der landwirtschaftlichen Produktion wird in neueren Studien dem Klimawandel mehr Gewicht beigemessen, der für das 14. Jahrhundert eindeutig nachweisbar ist und die klimatischen Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft negativ beeinflusst hat.[293] So folgte nun der Übergang in die sogenannte Kleine Eiszeit. Hinzu kamen die durchaus nicht unüblichen Wellenbewegungen von diversen, oft lokalen Epidemien,[294] mit dem Schwarzen Tod als der dramatischste Einschnitt und extrem hohen Todeszahlen (siehe oben).
Die sozioökonomischen Folgen der Pest sind hierbei besonders hervorzuheben. Werner Rösener schreibt dazu: „Der Rückgang der Bevölkerung im 14. Jahrhundert ist eines der wichtigsten Ereignisse der deutschen und der europäischen Geschichte des Spätmittelalters. Die Pestwellen erfaßten die einzelnen Regionen zwar mit unterschiedlicher Intensität, doch wirkten sie insgesamt so nachhaltig, daß sie besonders für die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse tiefgreifende Folgen mit sich brachten.“[295] An dieser Feststellung hat sich in der neueren Forschung nichts geändert, die hohen Todesraten (wenngleich regional in Europa unterschiedlich und bis zu 60 %[296]) führten zu tiefgreifenden Veränderungen in der europäischen Wirtschaft.[297] Arbeitskraft erhielt nun einen erhöhten Wert, während das alte Wirtschaftsmodell der Großgrundbesitzer erschüttert wurde. In England und Frankreich erhöhten sich soziale Spannungen, verstärkt durch den Krieg zwischen beiden Ländern und Steuerdruck, und führten zu zwei großen Bauernaufständen (der Jacquerie in Frankreich 1358 und dem Bauernaufstand von 1381 in England), auf die unten in den Kapiteln zu England und Frankreich näher eingegangen wird.[298]
Ein weiteres Problem stellen die spätmittelalterlichen Wüstungen dar, unfruchtbare oder zerstörte Güter, die in den zeitgenössischen lateinischen Quellen als villa deserta, villa inculta oder ähnlich bezeichnet werden und ungleichmäßig auftraten. Als Ursachen wurden verschiedene Faktoren diskutiert-[299] In der älteren Forschung wurde oft die sogenannte spätmittelalterliche Agrarkrise eng damit verknüpft, es habe sich um eine Produktionskrise als eine Folge der Pest gehandelt, mit einem Rückgang der Getreideproduktion für die geringere Bevölkerungszahl. Dieses Erklärungsmodell wird in der neueren Forschung allerdings skeptischer betrachtet.[300] So wird inzwischen etwa ein Zusammenhang von Klimaschwankungen und Wüstungsbildung hergeleitet. Der wirtschaftliche Ansatz der sogenannten Agrarkrise ist ebenfalls inzwischen umstritten: „Kritik gegen die globalen Entwürfe von Agrardepression und allgemeiner Krise der spätmittelalterlichen Wirtschaft erwuchs vor allem aus regionalen und sektoralen Sonderstudien. Forschungen der letzten Jahrzehnte haben gezeigt, dass die Krisen-Modelle nicht ohne weiteres auf alle Sektoren der Wirtschaft und alle Regionen zu übertragen sind.“[301] Allerdings bietet das ältere Agrarkrisenmodell, das Wilhelm Abel geprägt hat, teils immer noch bedenkenswerte Ansätze, wenngleich diese durch die neueren Umwelt- und Klimaforschungen zu ergänzen seien, so habe man sich unter anderem zu sehr auf die Pestfolgen konzentriert. Die damalige Agrarwirtschaft zeige zwar krisenhafte Züge, diese „Agrardepression“ betreffe aber vor allem den Getreideanbau, nicht etwa Viehzucht oder Weinbau; des Weiteren müsse man stärker das Rahmengeschehen (mit Hungersnöten vor der Pest), Bevölkerungsstruktur und die spätmittelalterliche Konjunkturentwicklung berücksichtigen.[302]
Frankreich
Regnum et Imperium – die deutsch-französischen Beziehungen im Spätmittelalter
Um 1300 gehörten die Gebiete von der Mündung der Schelde über Cambrai, dann die Region etwa entlang der Maas über die Städte Verdun und Toul, das Gebiet der Freigrafschaft Burgund, Savoyen, die Provinzen Lyonnais und Vivarais bis zum Mittelmeer zum römisch-deutschen Reich.[303] Unter den Kapetingern profitierte Frankreich von der Schwächephase des Imperiums und betrieb bereits in der späten Stauferzeit eine Expansionspolitik im romanischen Grenzraum, wobei die Intensität nach dem Tod Friedrichs II. (1250) zunahm.[304] Die Grenze zwischen dem französischen Regnum und dem römisch-deutschen Imperium wies teils strittige Grenzfragen auf, zumal in diesem Raum die Doppelvasallität eine nicht unwichtige Rolle spielte,[305] so dass einige Landesherren für Teile ihrer Gebiete sowohl dem französischen als auch dem römisch-deutschen König verpflichtet waren. Schiedskommissionen sollte auftretende Probleme regeln, da es keine schriftlich exakt fixierte Grenze gab, doch brachen bald kleinere Konflikte aus und Frankreich erhöhte den Druck auf lokale Herren.[306]

Den südlichen Grenzraum bildete das zum Imperium gehörende Königreich Burgund, das aufgrund der Krönungsstadt Arles im Spätmittelalter auch als Arelat bezeichnet wurde. Diese Zugehörigkeit bestand bereits seit dem frühen 11. Jahrhundert, doch war der Einfluss der römisch-deutschen Könige auf diesen Raum traditionell sehr schwach ausgeprägt; im 13. Jahrhundert dann war „die Vorstellung einer Zugehörigkeit dieser Gebiete zum deutschen Reich nicht völlig verschwunden, aber das war dann auch schon alles“.[307] Gerade deshalb konzentrierte sich die französische Expansionspolitik besonders auf diesen Raum,[308] so dass sich bereits Rudolf von Habsburg dem entgegenstellte und militärisch in Savoyen und Burgund intervenierte.[309] Tatsächlich ist auch bei den anschließenden Königen von Adolf von Nassau über Albrecht I. bis Heinrich VII. zu erkennen, dass gerade die rheinischen Kurfürsten vom König ein politisches Engagement erwarteten; Adolf von Nassau enttäuschte ebenso wie Albrecht, letzterer lehnte sich sogar stark an den mächtigen französischen König Philipp IV. an. Heinrich VII. hingegen, der vor seiner Königswahl exzellente Kontakte zum Königshof von Paris pflegte, erwies sich als römisch-deutscher König als Gegner Philipps IV. und erzielte durchaus kleinere Erfolge.[310] Als Protest gegen die Besetzung Lyons 1310 (die Stadt gehörte formal zum Imperium) brach er die Kontakte mit Philipp ab und bezichtigte ihn des Länderraubs. Sein Nachfolger Ludwig IV. schwankte nach Ausbruch des Hundertjährigen Krieges 1337 in einer Schaukelpolitik zwischen England und Frankreich.

Heinrichs Enkel Karl IV. unterhielt gute Kontakte zu Paris, wo er einen guten Teil seiner Jugend verbracht hatte. Ende 1377 reiste er sogar zum französischen König Karl. V., seinem Neffen, der ihn Anfang 1378 herzlich empfing.[311] 1365 hatte sich Karl IV. in Arles auch zum König von Burgund krönen lassen, was im Mittelalter ein sehr seltenes Ereignis war. Dennoch stellte sich der Kaiser dem weiterhin bestehenden Druck nicht entgegen, im Gegenteil: Nachdem er Karl V. im Dezember 1356 bereits die Dauphiné übergeben hatte[312] (dieser war damals noch Kronprinz und darauf beruht die Bezeichnung der französischen Thronerben als Dauphin), bestellte er nun den französischen Prinzen und späteren König Karl VI. zum Reichsvikar über das Arelat.[313] Hintergrund dafür war der Wunsch des Kaisers nach französischer Unterstützung für die Machtansprüche seines Hauses in Polen und Ungarn.[314] Formal wurde der Dauphin zum Lehnsmann des Kaisers,[315] doch faktisch gab Karl IV. die Region aus dynastischen Interessen an Frankreich preis, wobei jedoch Savoyen bereits 1361 aus dem Arelat herausgelöst und somit nicht betroffen war. Im Kern erkannte Karl IV. damit den Verlust des Arelats an Frankreich an. Wenzel und Karl VI. trafen sich 1398, um die Beendigung des Schismas zu besprechen.[316]
Sigismund unterhielt insgesamt gute Kontakte zum Hof von Paris, da er die expansive Politik des Hauses Burgund als gemeinsame Bedrohung betrachtete und ihm sehr daran gelegen war, das Kirchenschisma zu beenden, wozu er sowohl Frankreich als auch England einbinden wollte.[317] Allerdings kam es zeitweise zu einer engeren Anlehnung Sigismunds an England (mit dem Bündnis im Vertrag von Canterbury (1416)), da sich das Verhältnis Sigismunds zum französischen König Karl VI. erheblich verschlechtert hatte, was aber weitgehend folgenlos blieb.[318] 1434 wurde dann ein Bündnis zwischen Sigismund und Karl VII. von Frankreich abgeschlossen, das sich vor allem gegen Burgund richtete, allerdings verständigten sich Karl VII. und Burgund nur ein Jahr später.[319] Friedrich III. wiederum erwog ein Zusammenwirken mit dem Hause Burgund, doch vermied er eine Konfrontation mit Frankreich; die expansive Territorialpolitik Burgunds bedrohte wiederum weiterhin Reichsrechte und stellte somit ein Problem dar. Zu militärischen Konfrontationen mit Frankreich kam es dann nach 1477, als Friedrichs Sohn Maximilian das burgundische Erbe antrat,[320] was zum habsburgisch-französischen Antagonismus in der Frühen Neuzeit führte.[321]
So kam es am Ausgang des Spätmittelalters zu ernsthaften militärischen Auseinandersetzungen zwischen Frankreich und dem Imperium, die sich vor allem aus dynastischen Interessen speisten, keineswegs aber aus früher oft unterstellten „nationalen Gegensätzen“ (Deutsch-französische Erbfeindschaft). Dennoch bestanden sicherlich teilweise gegenseitige Ressentiments, die aggressive französische Expansionspolitik verletzte objektiv Reichsrechte und führte daher zu einer entsprechenden Gegenreaktion.[322] Hierbei spielten die jeweiligen Selbstverständnisse eine Rolle, dennoch stellt Jean-Marie Moeglin fest: „In dem großen dynastischen Konflikt der Häuser von Österreich und Frankreich, der sich Ende des 15. Jahrhunderts abzeichnete, waren die nationalen Gegensätze noch lediglich ein Vorwand, der von den Fürsten beliebig vorgebracht wurde, wann immer ihre dynastischen Interessen es erforderten, und der fallen gelassen wurde, sobald dies nicht mehr der Fall war.“[323] Die wirtschaftliche und kulturelle Verflechtung gerade im Grenzraum beider Reiche war im Spätmittelalter aber hoch und blieb davon weitgehend unangetastet, ebenso wie gerade die französische Hofkultur wirkungsmächtig war.[324]
Frankreichs Aufstieg zur europäischen Großmacht unter den späten Kapetingern
Das Königreich Frankreich entwickelte sich im 13. Jahrhundert zur bedeutendsten politischen Kraft in Westeuropa.[325] Im Inneren begann in dem bevölkerungsreichsten Land Europas unter den Kapetingern der Ausbau zu einer „nationalen Monarchie“, mit einem stark ausgeprägten monarchischen Selbstbewusstsein (rex Christianissimus) und gestützt auf eine funktionierende Reichsverwaltung mit regionalen Amtsträgern (siehe unten).[326]
Ludwig IX., einer der bedeutendsten französischen Könige des Mittelalters,[327] baute die königliche Zentralgewalt aus, indem er das Pariser Hofgericht etablierte und somit ein zentrales Herrschaftsinstrument zur überregionalen rechtlichen Durchdringung schuf. Sein außenpolitischer Handlungsbereich war ebenso beachtlich wie sein Ansehen, doch starb er 1270 während des 6. Kreuzzugs. In der Regierungszeit seines Sohns und Nachfolgers Philipps III. begann der französische Druck im Grenzraum zum Imperium zu steigen. Im Inneren setzte er die Zentralisierung der Königsgewalt fort und erweiterte die Krondomäne. Er führte ebenso einen Konflikt mit Aragon (Aragonesischer Kreuzzug), in dessen Verlauf der König 1285 verstarb. Sein Onkel Karl von Anjou intervenierte in Unteritalien, riss dort die Königsherrschaft an sich, verlor aber 1282 infolge eines Aufstands die Herrschaft über Sizilien; doch regierte fortan bis ins frühe 15. Jahrhundert das Haus Anjou im Königreich Neapel.

Von 1285 bis 1314 regierte in Frankreich Philipp IV., genannt „der Schöne“.[328] Er war ein sehr machtbewusster Herrscher, der die zentrale Königsmacht stärkte und ausbaute. Er trieb die Expansionspolitik im Grenzraum voran, was zu Konflikten mit dem Imperium führte, doch blieb die französische Einflussnahme hoch, so dass sogar eine französische Kandidatur für die römisch-deutsche Königswürde nicht unmöglich schien, wie ein gescheiterter Wahlvorstoß 1308 zeigte.[329] Philipp versuchte die Kaiserkrönung Heinrichs VII. 1312 vergeblich zu verhindern und generell das Imperium zu schwächen. Gleichzeitig war Philipps Politik sehr kostspielig. So kam es in Flandern zu langen und blutigen Auseinandersetzungen um die Lehnshoheit über dieses Gebiet mit Graf Guido, wobei 1302 ein französisches Ritterheer in der Sporenschlacht unterlag und man 1305 nur einen mühsamen Kompromissfrieden schließen konnte. Von 1294 bis 1297 kam es des Weiteren ebenfalls wegen Lehnsfragen hinsichtlich der englischen Kontinentalbesitzungen in Südwestfrankreich (der Guyenne) zum Konflikt mit dem englischen König Eduard I. (siehe siehe unten). Eduard wurde wegen Rechtsbrüche seiner Amtsträger 1293 vorgeladen. Philipp nutzte hierbei explizit seine Position als Lehnsherr und damit oberste Autorität in Rechtsfragen, um gegen einen mächtigen Lehnsnehmer vorzugehen.[330] Es kam 1294 bis 1297/98 zum Krieg und zu einer anschließenden formalen Verständigung, wobei aber Spannungen bestehen blieben. Mit Bonifatius VIII. kam es dann zu Beginn des 14. Jahrhunderts aufgrund der Besteuerung des französischen Klerus durch Philipp zum Zerwürfnis. Bonifatius erließ die berühmte päpstliche Bulle Unam Sanctam, worin der absolute Führungsanspruch des Papsttums auch in weltlichen Fragen postuliert wurde, wogegen sich Gelehrte wie Aegidius Romanus argumentativ wehrten. Philipp reagierte radikal und ließ den Papst zeitweilig festnehmen (Attentat von Anagni 1303), was eine tiefe Demütigung für das Papsttum an sich darstellte. Seit 1309 residierte Papst Clemens V. in Avignon, der dem französischen Druck schließlich erlag.[331] Dies war der Beginn des sogenannten Avignonesischen Papsttums, eine Zeit, in welcher der französische Einfluss an der Kurie dominierend war. Bereits 1306 hatte Philipp massenhaft Juden ausweisen und ihr Vermögen beschlagnahmen lassen, 1307 begann der berüchtigte Templerprozess, der 1312 mit der endgültigen Zerschlagung des Ordens endete, wovon der französische König finanziell ebenfalls profitierte. Juristisch geschulte Berater (Legisten) spielten eine wichtige Rolle bei Philipps Bemühungen zur Intensivierung der Königsherrschaft, darunter besonders Pierre Flote, Guillaume de Nogaret, Enguerrand de Marigny und Guillaume de Plaisians.
Frankreich im Zeitalter des Hundertjährigen Krieges
Bald nach dem Tod Philipps IV. 1314 brach eine schwerwiegende Nachfolgekrise aus. Seine Söhne Ludwig X. und Philipp V. regierten nur kurze Zeit, es kam zu Probleme im Inneren und der Konflikt mit Flandern flammte wieder auf. Mit Karl IV. regierte von 1322 bis 1328 der letzte männliche Kapetinger. Nach seinem Tod folgte ihm Philipp VI. aus dem Haus Valois nach,[332] einer Seitenlinie der Kapetinger.[333]
Unter anderem aufgrund konkurrierender Thronansprüche des englischen Königs Eduard III. Plantagenet begann 1337 der bis 1453 andauernde Hundertjährige Krieg, der überaus wechselhaft verlief und brutal geführt wurde.[334] Die Bedeutung dieses Konflikts für die spätmittelalterliche Geschichte Europas steht außer Frage. Die zahlreichen ausgedehnten Feldzüge und regionalen Begleitkonflikte verheerten nicht nur weite Teile Frankreichs, mit teils hohen Opferzahlen und materiellen Zerstörungen, der Konflikt betraf ebenso benachbarte Reiche. Im militärischen (wie der Einsatz primitiver Kanonen) und administrativen Bereich gab er aber ebenso Modernisierungsimpulse. Es handelte sich hierbei allerdings weniger um einen Konflikt zwischen zwei Staaten, sondern zwischen zwei Lehnsverbänden. Das englische Königshaus Plantagenet schuldete dem französischen König seit dem Vertrag von Paris (1259) die Lehnstreue für die kontinentalen Besitzungen, die Guyenne, was immer wieder für Konfliktstoff sorgte (siehe unten). Eduard III. machte seine Abstammung mütterlicherseits von den Kapetingern geltend, nachdem er Philipp VI. noch 1329 scheinbar formal als König anerkannt hatte. Dennoch war der englische Thronanspruch nicht der allein entscheidende Kriegsgrund, vielmehr spielten mehrere Faktoren (wirtschaftliche wie politische) eine Rolle.[335] 1337 entflammte der Konflikt, nachdem Eduard in Flandern intervenierte, wo die Engländer Interessen hatten und diese Region als Aufmarschgebiet nutzen wollten. Philipp VI. zog die Guyenne, die wirtschaftlich bedeutsam für die Engländer war, daraufhin als Lehen ein. 1338 setzte Eduard auf den Kontinent über und erklärte sich Anfang 1340 offen zum König von Frankreich.

Man kann den Krieg in verschiedene Phasen einteilen.[336] In den ersten Kriegsjahren bis etwa 1360 wurden die englischen Truppen insgesamt besser geführt und errangen beachtliche Erfolge, so im August 1346 in der Schlacht bei Crécy, in der die Franzosen vernichtend geschlagen wurden. Hier standen sich zum ersten und einzigen Mal während des Hundertjährigen Krieges beide Könige persönlich im Feld gegenüber. Denn obwohl im weiteren Verlauf mehrmals Könige an der Spitze ihrer Heere standen (was das mittelalterliche Königsideal des „Königs als Krieger“ reflektiert), wurden riskante Schlachten nicht unbedingt gesucht.[337] Die Schlacht von Crécy stellt die einzige Königsschlacht in diesem Konflikt dar, wobei Philipp VI. anscheinend taktisch versagte, was sich in der zeitgenössischen Geschichtsschreibung widerspiegelt.[338] Die Kämpfe hörten damit aber nicht auf und wurden immer wieder von Waffenstillstandsphasen unterbrochen. Ein zentrales Problem stellte nun und in der folgenden Zeit die Finanzierung des Krieges dar, weshalb etwa 1341 eine wichtige Salzsteuer eingeführt wurde.[339] Nach dem Tod Philipps VI. 1350 folgte ihm sein Sohn Johann II. nach und erbte den Konflikt, wobei seine Position im Inneren schwächer gewesen zu sein scheint als die seines Vaters.[340] Er geriet in der Schlacht von Poitiers (1356) in englische Gefangenschaft, was eine extreme Demütigung Frankreichs darstellte und weitreichende politische Folgen hatte. 1360 kam es im Friede von Brétigny zu einer Regelung, wobei Frankreich auf weite Gebiete im Westen und Norden verzichtete, nachdem es Eduard III. zuvor aber auch nicht gelungen war, Paris zu erobern.[341] Johann kam 1364 frei, starb aber kurz darauf.
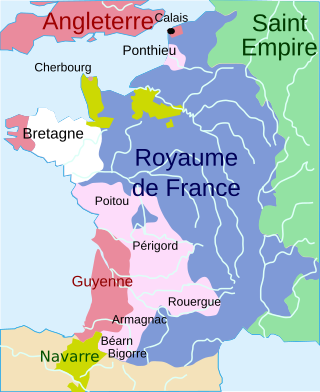
Sein Sohn Karl V. hatte es als Kronprinz mit aufmüpfigen Generalstände zu tun gehabt,[342] deren Vertreter die Chance sahen, ein stärkeres Mitspracherecht einzufordern und die hohe Steuerbelastung aufgrund des Krieges anprangerten. Karl konnte sich schließlich Ende 1357 durchsetzen, doch brach 1358 zudem ein großer Bauernaufstand aus, die sogenannte Jacquerie.[343] Der lokale Aufstand weitete sich bald auf Teile Nordfrankreichs aus, war aber wenig organisiert und wurde noch im selben Jahr brutal niedergeschlagen. Hinzu kamen die Folgen der großen Pest. Der Frieden mit England erwies sich derweil als brüchig und verschaffte beiden Seiten nur Atempausen, wobei sich Karl V. nie mit den englischen Forderungen abgefunden hatte. „Karl der Weise“ setzte innenpolitisch auf die Festigung der Königsmacht.[344] So erhöhte er den Steuerdruck und führte die königliche Zentralisierung trotz Widerstände fort. Die Einnahmen des französischen Königs in dieser Zeit waren enorm und ermöglichten die Mobilisierung erheblicher Ressourcen, was sich nicht zuletzt militärisch bemerkbar machte.[345]
1369 brach der Krieg erneut aus und leitete eine Phase ein, die etwa bis 1399 andauern sollte.[346] Beide Seiten intervenierten zudem für jeweils unterschiedliche Seiten auch in Kastilien, wo es zu Thronkämpfen gekommen war. In Frankreich waren die Franzosen nun erfolgreicher gegen die Engländer, die im Südwesten immer mehr in die Defensive gerieten, Anfang der 1370er Jahre herrschte im Prinzip eine Pattsituation.[347] Bei den Kämpfen in Frankreich hatte sich Edward of Woodstock, ein Sohn Eduards III., wiederholt ausgezeichnet, er starb aber 1376, ein Jahr vor seinem Vater. Der neue englische König, Richard II., war noch nicht volljährig. Die militärische Situation hatte sich zudem nicht gebessert: Bertrand du Guesclin hatte weite Teile Frankreichs von der englischen Besatzung befreit, wenngleich das Land unter den Jahren der Kriegsführung, Steuerbelastung und marodierenden Söldnern gelitten hatte. Nach 1380 entsandten die Engländer für mehrere Jahre keine größere Streitmacht mehr auf den Kontinent. In Flandern erstickten die Franzosen zudem 1382 einen aufkeimenden Aufstand. Eine vorübergehende Waffenruhe zwischen Frankreich und England wurde 1389 beschlossen, im März 1396 folgte ein mehrjähriger Waffenstillstand. Denn Frankreich war trotz der militärischen Erfolge erschöpft. Die Finanzkraft der französischen Monarchie war in dieser Zeit ungebrochen hoch, auch weil die Kämpfe abebbten; gleichzeitig nahm der Einfluss der Generalstände in dieser Zeit ab.[348] Dennoch wurde Frankreich bald im Inneren von schweren Machtkämpfen erschüttert.

Seit 1380 regierte in Frankreich Karl VI., der bis 1422 formal herrschen sollte.[349] Da er aber noch minderjährig König wurde, kam es zur Regierung der Herzöge. 1388 übernahm Karl selbst die Regierung, doch litt er unter einer Geisteskrankheit, so dass er ab 1392 nicht mehr eigenständig regierte. Nun konkurrierten Philipp von Burgund und Ludwig von Valois um die Macht.[350] Das Haus Burgund, eigentlich eine Nebenlinie des Hauses Valois, betrieb eine eigenständige Politik und erweiterte seine (überaus reichen und im Norden stark urbanisierten) Besitzungen stetig.[351] Philipps Sohn, Johann Ohnefurcht, hatte einen regelrechten Hass auf Ludwig entwickelt und ließ ihn 1407 ermorden, womit er aber zu weit gegangen war.[352] Die Folge war der Bürgerkrieg der Armagnacs und Bourguignons, also zwischen den ehemaligen Anhängern Ludwigs und dem Hause Burgund, was fatale Folgen haben sollte.[353]
1415 nutzte der junge englische König Heinrich V. die Lage in Frankreich aus und erneuerte seine Ansprüche auf den französischen Thron. Er sollte geradezu märchenhafte Erfolge feiern,[354] 1415 wurde zu einem „Jahr des Ruhms“.[355] Am 25. Oktober 1415 vernichteten die Engländer ein zahlenmäßig überlegenes französisches Heer in der Schlacht von Azincourt; die Schlacht selbst wurde ein Mythos für die Engländer und ein Albtraum für die Franzosen.[356] Der organisierte Widerstand brach weitgehend zusammen, Heinrich fiel die französische Krone nun fast kampflos zu. Am französischen Königshof waren die Armagnaken im Machtkampf mit den Burgundern unterlegen. Johann von Burgund wurde aber 1419 in eine Falle gelockt und ermordet. Drahtzieher dieser Tat war der französische Kronprinz Karl, der vom Königshof nach Bourges floh und weiterhin gegen die Engländer und die Burgunder stand. Im Vertrag von Troyes wurde 1420 festgelegt, dass Heinrich (der Katharina, die Tochter Karls VI., heiratete) dem geisteskranken König Karl VI. nachfolgen sollte, so dass England und Frankreich in einer Personalunion verbunden wurden, womit der Dauphin Karl übergangen wurde. Heinrich V. starb aber bereits 1422, nur wenige Wochen später folgte ihm Karl VI. Heinrichs Sohn war noch ein Baby, der Thronkampf entbrannte so erneut.

Den Vertrag von Troyes hatte maßgeblich Philipp von Burgund vorangetrieben, der Sohn des ermordeten Burgunderherzogs Johann, der 1420 ein Bündnis mit England schloss. Gegen die burgundische Partei stand nun der Dauphin, der seinen Anspruch nicht aufgab und als Karl VII. den Kampf fortsetzte.[357] Dies leitete die letzte Phase des Hundertjährigen Krieges ein.[358] Frankreich hatte nun zwei Könige, wobei Karl ungekrönt war und nicht einmal Paris kontrollierte, wo die weiterhin bestehende anglo-burgundische Koalition die Regierung führte und auch militärisch überlegen blieb. Er war zwar nicht ganz ohne Verbündete, wobei verschiedene Adelige sich ihm anschlossen und seine Schwiegermutter Jolanthe von Aragón einflussreich war. Gleichzeitig war aber seine Legitimation problematisch, außerdem gab es Machtkämpfe an seinem Hof. In Frankreich regierte derweil als englischer Statthalter John of Lancaster, 1. Duke of Bedford, wobei die anglo-burgundische Koalition erste Risse zeigte. Philipp von Burgund gefiel es nicht, dass er Bedford untergeordnet war, zudem konkurrierten englische und burgundische Handelsinteressen (englische Wolle und burgundische Tuchproduktion in den Niederlanden). 1428/29 begann eine englische Offensive, die zur Belagerung von Orléans führte. Das Erscheinen der Jeanne d’Arc (Johanna von Orleans) wendete den Kriegsverlauf dann unerwartet zugunsten Frankreichs.[359] Die sehr junge Bauerntochter sprach davon, ein Instrument des göttlichen Willens zu sein und inspirierte die französischen Truppen. Johanna selbst wurde zu einem Mythos, doch für Zeitgenossen waren göttliche Wundererscheinungen durchaus vorstellbar. Die Franzosen siegten 1429 über die Engländer, Karl zog im Juli zur Königssalbung nach Reims ein. Der Vertrag von Arras (1435) beendete die Feindschaft mit dem Herzog von Burgund, die anglo-burgundische Allianz war zerbrochen, wenngleich Karl den Burgundern Zugeständnisse machen musste.[360] Bereits zuvor war allerdings Johanna, die 1430 in Gefangenschaft geraten war, an die Engländer ausgeliefert und 1431 hingerichtet worden. Die Engländer waren aber bereits endgültig in die Defensive gedrängt. 1436 fiel Paris an Karl, der die alte Hauptstadt mied; er wurde zum ersten der sogenannten Loire-Könige, die außerhalb residierten. Bis 1453 verloren die Engländer alle Festlandsbesitzungen, ausgenommen den Stützpunkt Calais.
1438 wurden die Rechte der Krone gegenüber der Kirche durch ein Gesetz festgeschrieben („Pragmatische Sanktion“), durch die sogenannten Ordonnanzkompanien wurde 1439/45 die Grundlage für ein stehendes Heer geschaffen. Widerstand gegen die (erneute) Festigung der Zentralgewalt wurde niedergeschlagen.[361] Aus Finanznot musste Karl wieder das Mittel der Generalstände nutzen, doch besserte sich die Finanzlage im Laufe der Zeit.[362] Am Ende seiner Regierungszeit waren die Engländer vertrieben, die Finanzen weitgehend saniert und der König verfügte über ein stehendes Heer; zwar bestanden immer noch Spannungen, da einflussreiche Adelsgruppen weiterhin konkurrierten, das Fundament der Monarchie war aber stabil.[363] Karl VII. regierte noch bis 1461, wobei gegen Ende seiner Herrschaft wieder Spannungen mit Burgund auftraten. Diese sollten sich unter seinem Nachfolger fortsetzen und verschärfen.
Das Ende des Hauses Burgund und der Übergang in die Frühe Neuzeit

Ludwig XI. regierte von 1461 bis 1483.[364] Er musste zu Beginn interne Widerstände von Adel und Klerus überwinden, die die Stärkung der Königsgewalt und Steuerdruck beklagten. So sah sich Ludwig dazu gezwungen, 1468 die Generalstände stärker einzubinden. Mehrmals ging Ludwig in seiner Regierungszeit gegen aufständische Herren vor und zog Adelsgüter ein, womit er die Königsmacht weiter festigte und zentralisierte. Dabei handelte der König nicht selten skrupellos, gleichzeitig erkannte er die Bedeutung der Wirtschaft und der Finanzpolitik. Am bedrohlichsten erwies sich für Ludwig die Stellung des Hauses Burgund. Karl der Kühne, Herzog von Burgund, herrschte über ein territorial zwar zersplittertes, aber aufgrund des Tuchgewerbes und des Fernhandels überaus wohlhabendes und bevölkerungsreiches Gebiet, mit einem vergleichsweise hohen Urbanisierungsgrad speziell in den burgundischen Niederlanden.[365] Die Finanzkraft und die prächtige Hofkultur des burgundischen Staates, der sowohl Besitzungen in Frankreich als auch im römisch-deutschen Reich umfasste, waren in ganz Europa bekannt. Karl der Kühne verfolgte ehrgeizige Ziele, die auf die Erlangung einer burgundischen Königskrone zuliefen und damit die Autorität des französischen Königs gefährdeten. Wie oben bereits beschrieben scheiterte Karl mit seinen Versuchen, von Kaiser Friedrich III. eine Königskrone zu erhalten, was ihn aber nicht davon abhielt, expansiv tätig zu sein, wovon auch Reichsgebiet betroffen war. So kam Karl in Konflikt mit der Eidgenossenschaft, Reichsstädten und lokalen Herren, die sich bedroht fühlten. In den sogenannten Burgunderkriegen kam es zu einer Reihe von Auseinandersetzungen: Im März 1476 unterlag Karl in der Schlacht bei Grandson und im Juni 1476 in der Schlacht bei Murten, am 5. Januar 1477 fiel der Herzog dann in der Schlacht bei Nancy.[366] Ludwig XI. hatte beständig und mit allen verfügbaren Mitteln gegen Karl gearbeitet, unterstützt von dem in seine Dienste übergelaufenen Philippe de Commynes, der zuvor ein Berater Karls gewesen war. Der Tod Karls befreite Ludwig von einem gefährlichen Widersacher und eröffnete der französischen Monarchie die Möglichkeit, die Besitzungen des Hauses Burgunds einzuziehen, da dieses nun in männlicher Linie erloschen war. Der Erbfolgekrieg mit dem Hause Habsburg zog sich noch über Jahre hin.[367] Im Frieden von Arras (1482) sicherte sich Frankreich aber bedeutende Teile des burgundischen Erbes, wenngleich Habsburg weiterhin über die wohl reichsten Gebiete verfügte und einige Fragen offen blieben.
Nach dem Tod Ludwigs rechneten vor allem Vertreter der Generalstände, die Anfang 1484 zusammentraten, mit seiner Politik ab, prangerten Steuerdruck und königliche Zentralisierung an; einige Adelige hofften, wieder Vorrechte zu erlangen. Doch die Vertreter des Königtums, die für den minderjährigen Thronfolger Karl zunächst die Regierungsgeschäfte führten, setzten sich durch.[368] Karl VIII. (1483 bis 1498) erbte ein wohlhabendes Land, erwies sich aber als eher schwacher König.[369] Er verleibte der Krone die Bretagne ein und führte den Konflikt mit den Habsburgern bezüglich Burgund fort, der im Vertrag von Senlis (1493) vorerst beendet werden konnte. Nach dem Tod Ferdinands von Neapel 1494 nutzte Karl die Gelegenheit, um Erbansprüche auf das Königreich Neapel geltend zu machen, wo einst das Haus Anjou regiert hatte. Er begann noch im gleichen Jahr eine Invasion Italiens.[370] Der Italienfeldzug 1494/95 scheiterte aber schließlich, Neapel ging wieder verloren, wobei sich die sogenannte Heilige Liga zur Abwehr der Franzosen gebildet hatte. Vor allem aber destabilisierte die französische Intervention die politischen Verhältnisse in Italien nachhaltig und war der Beginn der sogenannten Italienischen Kriege, in die sich auch das Haus Habsburg einmischte und die noch bis ins frühe 16. Jahrhundert andauern sollten.[371] Damit war die ambitionierte Außenpolitik Karls gescheitert, innenpolitisch war die Lage finanziell nun angespannt, zumal Seuchen im Land grassierten. Mit seinem Tod im April 1498 wird in der Regel das Ende des französischen Mittelalters verknüpft.
Die innere Entwicklung: Vom Königsstaat zur Königsnation
Die Quellenüberlieferung erlaubt hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung nur ungefähre Vorstellungen. Sicher ist, dass Frankreich im Spätmittelalter das bevölkerungsreichste Land Europas war. Im frühen 14. Jahrhundert hatte das Königreich geschätzt zwischen 19 und 22 Millionen,[372] bzw. in den (heutigen Grenzen) rund 20 Millionen zum Zeitpunkt des Pestausbruchs.[373] Die Pest erreichte Frankreich Ende 1347 über die Häfen am Mittelmeer (einem wichtigen Handelsknotenpunkt) und verbreitete sich anschließend 1348 wie ein Lauffeuer über die Handelsrouten im ganzen Land.[374] Neueren Studien zufolge mag die Todesrate bis zu 60 % betragen haben.[375] Jedenfalls ist auch bei geringeren Todeszahlen von einem erheblichen Bevölkerungsrückgang in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts auszugehen, hinzu kamen Verluste durch den Krieg mit England.[376] Eine Folge des Bevölkerungsrückgangs war, dass Arbeitskraft nun einen höheren Wert besaß;[377] dies stellt eine Parallele zur Entwicklung in England dar. Ab Ende des 15. Jahrhunderts nahm dann die Bevölkerung in der Folgezeit stetig zu.[378]

Die Folgen des Hundertjährigen Krieges, Klimaverschlechterung, Seuchen und Begleitfolgen belasteten die Wirtschaft vor allem im 14. Jahrhundert. Hinzu kamen soziale Spannungen,[379] die sich 1358 in einem großen Bauernaufstand entluden, der Jacquerie.[380] Hintergrund waren nicht nur die Folgen der Pest, sondern die schlechten Rahmenverhältnisse. 1356 war König Johann II. in englische Gefangenschaft geraten, anschließend stieg der Druck auf den Dauphin Karl (den späteren französischen König Karl V.), Reformen durchzuführen. Im Herbst 1357 kam es zu einem Aufstand in Paris unter Führung des Marktvorstehers Étienne Marcel. Ende Mai 1358 brach dann im Beauvaisis ein Bauernaufstand gegen die adeligen Grundherren aus, der sich ausweitete und mehrere Adelige das Leben kostete, einige Herrenhäuser und Burgen wurden zerstört. Der Aufstand war jedoch keine reine Bewegung der Ärmsten, die Auswertung der (weitgehend parteiisch gegen die Aufständischen gefärbten) Quellen belegt vielmehr, dass sich auch durchaus mittlere soziale Gruppen daran beteiligten.[381] Der Aufstand wurde kurz darauf im Juni 1358 blutig niedergeschlagen, nach der Ermordung Marcels wenige Wochen später wurde in Paris ebenfalls die alte Ordnung wiederhergestellt. Die Aufstände hatten sich dabei nicht gegen die Krone gerichtet, sondern resultierten in erster Linie aus bestehenden Missständen, wobei es enge Bindungen zwischen der Revolte in Paris und dem Aufstand der Jacquerie im ländlichen Raum gab.
Im Hinblick auf die Wirtschaftskraft waren Landwirtschaft (mit dem neben Weizen als Hauptgetreide wichtigen Weinanbau vor allem im Süden), Gewerbe und Handel bedeutsam. Die wirtschaftliche Erholung im 15. Jahrhundert verlief regional unterschiedlich und begann dort früher, wo es zu keinen Kampfhandlungen mehr kam.[382] Wein war das wichtigste Exportgut, im 15. Jahrhundert nahm die Bedeutung der Textilhandels erheblich zu. Städte und lokale Messen spielten hierbei eine zunehmend größere Rolle.[383] Des Weiteren gewann der Seehandel im Mittelmeerraum an Bedeutung. Jacques Cœur wurde zum Sinnbild der wirtschaftlichen Erholung im 15. Jahrhundert (so lieh er selbst dem König große Summen Geld), wenngleich sein Fall dramatisch war.
Frankreich überstand Mitte des 14. Jahrhunderts und dann im frühen 15. Jahrhundert schwere Krisenphasen: Die englische Bedrohung von außen, marodierende Söldner, Machtkämpfe am Hof, die Folgen der Pest mit hohen Todesraten, Bauernaufstände und wirtschaftliche Probleme. Frankreich entwickelte sich, wie Heribert Müller meinte, im 15. Jahrhundert von einem Königsstaat zu einer Königsnation. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts herrschten bürgerkriegsähnliche Zustände und um 1420 schien England als der große Sieger aus dem blutigen Kämpfen um den französischen Thron hervorgegangen zu sein. Doch die nachfolgende Entwicklung bewies, dass der spätmittelalterliche französische Staat, um 1420 reduziert auf ein Rumpfreich im Süden mit einem ungekrönten König, keineswegs hilflos war. Das Jahr 1429 und die folgenden Ereignisse zeigten vor allem die Integrationskraft der französischen Königsidee, wobei sich der Monarch auf die weiterhin funktionierenden Verwaltungsstrukturen stützen konnte: „Eine gelehrte Elite propagierte in jenen Jahren der Not einen einheitsstiftenden Königsmythos, der ein in breiteren Kreisen offensichtlich schon vorhandenes Gemeinschaftsgefühl, einen royalistisch getönten Patriotismus ansprach – der Staat hatte eben die Grundlagen der Nation gelegt.“[384] Kulturell wurde das Französische als Schriftsprache gestärkt, es trat auch in gelehrten Kreisen, in der Jurisprudenz und in der Verwaltung zunehmend an die Stelle des Lateinischen. 1437 wurde Jean Chartier von Karl VII. beauftragt, die Grandes Chroniques de France fortzuführen, eine ganz den Zielen der Monarchie dienende Hofgeschichtsschreibung.
Diese „nationale Monarchie“ (wenngleich kein Nationalstaat) baute auf einem administrativen Fundament der späten Kapetingerzeit auf, in der das Königtum Verwaltung, Justiz und Finanzen (mit Rechnungskammer) ausgebaut und auf den Königshof in Paris zentriert hatte. Vor allem das Hofgericht, das Parlement de Paris, entwickelte sich vom obersten Adelsgericht zur höchsten Rechts- und Appellationsinstanz,[385] wobei der König tonangebend war, während der königliche Rat als Beratungsgremium diente. Ebenso wurde die Krondomäne ausgebaut und der sakrale Charakter des Königtums betont (rex Christianissimus). Das Land war in administrative Distrikte unterteilt, die von Baillis (im Norden) und Sénéchaux (im Süden) verwaltet wurden. Die vom König eingesetzten lokalen Amtsträger sorgten für die Durchsetzung von Erlassen und waren für die Steuereintreibung (wie die taille und Sondersteuern) zuständig. Gerichtsurteile und Berichte der Rechnungskammer wurden seit dem frühen 14. Jahrhundert archiviert und waren somit nachprüfbar. Die durch die Ordonnanz von Vivier-en-Brie 1320 neu geregelte Chambre des comptes überwachte die Verwaltung der beachtlichen Krongüter, während die Kanzlei (Chancellerie) den notwendigen Schriftverkehr regelte. Der französische König verfügte so in der späten Kapetingerzeit über vergleichsweise große Ressourcen und Herrschaftsinstrumente zur Durchsetzung seiner Politik.[386] Die Rolle der Generalstände schwankte, doch verhinderten sie nicht die königliche Herrschaftsverdichtung.[387] So hatten Vertreter der États généraux (die nur sehr unregelmäßig zusammentraten) keine wirkliche Teilhabe an der Reichspolitik, sondern waren nur in die Zustimmung zu Steuerfragen eingebunden, woraus sich aber kein Gegengewicht zur Königsmacht entwickelte.
Wichtig waren die Gerichte (Parlements, die nicht als Ständevertretungen missverstanden werden dürfen, da es sich nicht um gesetzgebende Institutionen handelte); neben dem Pariser Hofgericht wurden im 15. und 16. Jahrhundert auch lokale Gerichtshöfe in den Provinzen eingerichtet.[388] Rechtsprechung diente im Kontext der königlichen Verdichtungspolitik als ein zentrales Herrschaftsmittel. Philipp IV. beispielsweise nutzte die Funktion der obersten Appellationsgerichtsbarkeit als Instrument, um gegen Lehnsnehmer vorzugehen, so gegen den Grafen Guido von Flandern oder 1293/94 gegen den englischen König Eduard (siehe oben), der Lehnsmann des französischen Königs für die Guyenne war. Philipp brach damit das Feudalsystem auf und beanspruchte die souveräne Herrschaft über das gesamte Reich.[389]

Die Valoiskönige knüpften an das kapetingische Königsideal nahtlos an.[390] Sie profitierten ebenso von den vergleichsweise gut funktionierenden Strukturen, wobei sie die Steuern, wie oben beschrieben, sogar noch in Kriegszeiten erhöhen (was zur Kriegsfinanzierung entscheidend war). Dazu gehören die gabelle (die wichtige Salzsteuer), Import-/Exportzölle und weitere Sonderabgaben, die im 14. Jahrhundert aufgrund der Kriegsfinanzierung notwendig wurden. Alles in allem verfügten die Valoiskönige im Vergleich zu den englischen und besonders zu den römisch-deutschen Herrschern über weitaus mehr mobilisierbare finanzielle Ressourcen. Ebenso wurden adelige Rechte beschnitten und wenn nötig sogar Lehen eingezogen. Die Durchsetzung der Lehnshoheit war hierbei ein zentraler Aspekt der Königsherrschaft, die königlichen Besitzungen wurden so fortlaufend erweitert. Das spätmittelalterliche Königtum der Valoiszeit erwies sich trotz zeitweiser Krisen als insgesamt gefestigt, die staatlichen Strukturen und verfügbaren Herrschaftsinstrumente grundsätzlich als (in Anbetracht der Zeitumstände) effektiv. Lokale Unruhen und Widerstände des Adels gegen die zentralisierte Königsmacht wurden überwunden.[391] Unter Karl VII. hatten dann qualifizierte Räte, Beamte und Diplomaten Anteil daran, Verwaltung und Finanzen funktionsfähig zu halten, die Autorität des Königtums wieder zu stärken und den Königsstaat zu festigen, wobei die Macht des Adels weitgehend eingedämmt war (mit Ausnahme Burgunds, was Ende des 15. Jahrhunderts geschah). Wirtschaft und Bevölkerung wuchsen wieder, es entwickelte sich der frühmoderne französische Staat der Renaissancezeit.[392]
England
England im Spätmittelalter: Insulare und kontinentale Politik

Bereits die geographische Lage als Teil der Britische Inseln hat die geschichtliche Entwicklung Englands maßgeblich beeinflusst.[393] Die spätmittelalterlichen englischen Könige handelten einerseits innerhalb des heutigen Englands, andererseits agierten sie politisch aber auch gegenüber dem Königreich Schottland, in Irland (wo die anglonormannische Eroberung ihren Höhepunkt längst überschritten hatte) und Wales[394] (den „keltischen Reichen“) sowie nicht zuletzt auf dem Kontinent. Seit der normannischen Eroberung 1066 waren England und der Kontinent viel enger als zuvor miteinander verknüpft, auch die folgenden Könige aus dem Hause Anjou-Plantagenet waren kulturell stark französisch geprägt; erst Eduard III. sprach ein gutes Englisch, nachdem zuvor Französisch die Hofsprache war.[395] Des Weiteren bestanden enge dynastisch-politische Beziehungen, zumal die englischen Könige über Besitzungen in Frankreich verfügten, wofür sie dem französischen König die Lehnstreue schuldeten, was für Konflikte sorgte (siehe unten). Im Inneren erfolgte im Spätmittelalter aber eine Anglisierung des Herrschaftsraums, was schließlich (ähnlich wie in Frankreich) zur Entstehung eines nationalen Königtums führen sollte.[396]
Die Pest, der damit einhergehende Bevölkerungsrückgang und die wirtschaftlichen Folgen führten zu dramatischen Veränderungen im spätmittelalterlichen England, die unten detaillierter ausgeführt werden. Ebenso wird die königliche Verwaltung (die in England vergleichsweise gut ausgebaut war) und die Entwicklung des Parlaments separat genauer geschildert. Grundsätzlich war der König auf das Parlament bei Gesetzgebung und Steuerfragen angewiesen, wobei dort zwei Gruppen vertreten waren, die hochadeligen Lords und der Klerus sowie die Vertreter der Grafschaften und Städte (die Commons). Das Parlament gewann nicht zuletzt aufgrund der Kriege mit Frankreich und des daraus resultierenden erhöhten Finanzbedarfs eine zunehmend größere Bedeutung.
Die eduardische Zeit: 1272 bis 1377
Mit Eduard I.[397] (1272 bis 1307) begann eine Epoche, die vor allem von militärischen Konflikten in England und gegen äußere Feinde gekennzeichnet war und schließlich im Ausbruch des großen Kriegs mit Frankreich 1337 gipfelte.[398] Eduard I. unternahm wiederholt Feldzüge gegen Wales, das der König erst nach harten Kämpfen und der Niederschlagung eines großen Aufstands 1294/95 weitgehend sichern konnte. Zeitgleich mit dem walisischen Aufstand war Eduard, zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt für ihn, auf dem Kontinent von 1294 bis 1297/98 in einen militärischen Konflikt mit Frankreich verwickelt, der sich am Status der englischen Besitzungen in Südwestfrankreich entzündet hatte (siehe unten). Hinzu kam seit 1296 der Krieg mit Schottland, der bis nach seinem Tod andauerte und wechselhaft verlief. Die Lordschaft Irland, der von der englischen Krone gehaltene Besitz auf der Insel Irland, spielte hingegen eine untergeordnete Rolle. Die kostspielige Außenpolitik[399] führte zu einer hohen finanziellen Belastung und einer erhöhten Besteuerungspolitik Eduards, was wiederum im Innern für Widerstand sorgte. Die Folge waren innenpolitische Spannungen (mit dem Höhepunkt im Jahr 1297),[400] wobei das Parlament (das ein zunehmend stärkeres Mitspracherecht in Steuerfragen hatte, siehe unten) insgesamt gestärkt wurde. Die Finanznot Eduards blieb akut, 1307 beliefen sich seine Schulden auf rund 200.000 Pfund.[401] Es handelte sich um eine astronomische Summe im Vergleich zur englischen Wirtschaftskraft; 1284 sollen sich die königlichen Einnahmen auf unter 27.000 Pfund belaufen haben und die gesamte im Umlauf befindliche Geldmenge dürfte bei nicht viel mehr als 1 Million Pfund gelegen haben.[402] Der König hatte sich gezwungen gesehen (wie andere englische Könige nach ihm) zur Kriegsfinanzierung Kredite bei italienischen Bankiers aufzunehmen, was die königlichen Schulden in die Höhe getrieben hatte, aber zumindest eine wirtschaftliche Belastung durch eine allzu drückende Besteuerung vermied. Ansonsten ist eine rege Gesetzgebungstätigkeit des Königs zumindest in den 1270er und 1280er Jahren hervorzuheben,[403] der aber auch 1290 die Ausweisung der Juden verfügte, wovon er selbst profitierte (Schuldentilgung und jüdisches Eigentum, das an die Krone überging).
Eduard wird als König (anders noch als in seiner Prinzenzeit) in den englischen Quellen weitgehend heroisiert, er galt als Verkörperung des Ritterideals.[404] Objektiv betrachtet war seine Außenpolitik eher mäßig erfolgreich, nur in Wales gelangen ihm längerfristige Erfolge, resultierend aus hart geführten Feldzügen. Vor allem in Schottland (wo er freilich negativ betrachtet wird) und teils auch gegenüber Frankreich kam es hingegen zu Rückschlägen.[405] Seine Regierungszeit offenbarte vor allem ein grundlegendes Problem des englischen Königtums im Spätmittelalter: Die finanziellen Ressourcen waren trotz der relativ großen Wirtschaftskapazität des Landes und der effizienten Verwaltung in Anbetracht einer weitgespannten Außen- und Eroberungspolitik nicht ausreichend und bedurften stets der Finanzierung durch neue, nun vom Parlament zu genehmigende Steuern oder Kreditaufnahmen durch Verschuldung.

Eduards Sohn Eduard II.[406] (1307 bis 1327) wird von Michael Prestwich, einem der führenden englischen Forscher für diesen Zeitraum, als schlicht inkompetenter Herrscher bezeichnet.[407] Tatsächlich vollzog sich in seiner Regierungszeit ein Niedergang der Königsmacht, doch dürfte die Beurteilung auch mit einer deutlich positiveren Bewertung seines Vaters und seines Sohns in der englischen Forschung zusammenhängen. Eduards Begünstigung Piers Gavestons, dem der König eng verbunden und vielleicht sogar homoerotisch zugeneigt war,[408] seine trotz der Schuldenlast verschwenderische Hofhaltung und sein weitgehendes Desinteresse an königlichen Verpflichtungen führten zu Konflikten mit mächtigen Adeligen. Gavestons Ermordung 1312 vertiefte die Gräben, während es in der Außenpolitik zu Rückschlägen kam, wie im Krieg gegen Schottland (Niederlage in der Schlacht von Bannockburn 1314) und auch gegenüber Frankreich, wo es wieder zum Konflikt kam. Die finanzielle Lage blieb angespannt, Versuche einer Reform der Fiskalverwaltung hatten nur mäßigen Erfolg. Hugh le Despenser nahm die Rolle des neuen ersten Günstlings Eduards ein, der 1321/22 führend daran beteiligt war, eine Adelsrevolte niederzuschlagen (Despenser War). Darauf folgte die unerbittliche Rache des Königs an seinen innenpolitischen Feinden, begleitet von zahlreichen Hinrichtungen.[409] In der Vita Edwardi Secundi, einer wichtigen Quelle zur Regierungszeit Eduards, wird denn auch an anderer Stelle passend vermerkt, dass es nicht sicher sei, sich gegen den König zu erheben, da das Ergebnis oft unglücklich ist.[410] Die Familie Despenser befand sich auf dem Höhepunkt ihrer Macht, doch formierte sich bald erneut Widerstand. Im September 1326 setzte Roger Mortimer, 1. Earl of March, nun offen der Geliebte von Eduards Ehefrau, der französischen Prinzessin Isabelle, nach England über und stellte sich an die Spitze der Opposition.[411] Eduards Herrschaft, die von seinen Gegnern als grausam und ungerecht bezeichnet wurde, brach rasch zusammen. Er wurde entthront und im September 1327 auf Befehl Mortimers und Isabelles ermordet, während an seinen Günstlingen ein Blutbad angerichtet wurde.
Wenngleich Eduard II. weitgehend negativ betrachtet wird, so war er doch auf dem Kontinent an einem Ausgleich mit Frankreich bemüht, um die Kriegs- und Steuerlast zu reduzieren, während seine charakterliche Bewertung durch die oft parteiische Färbung vieler Quellen erschwert wird, denen die wenig kriegerische Gesinnung und der Umgang des Königs missfiel.[412] Trotz mancher Schwächen betont auch Seymour Phillips, der die derzeit grundlegende Biographie des Königs verfasst hat, dass Eduard II. keineswegs ein unfähiger König gewesen sei, vielmehr sei er ein rätselhafter Herrscher. Sein Konflikt mit mächtigen Adelsgruppen, eine zu loyale Günstlingspolitik (speziell gegenüber der Familie Despenser), Charakterschwächen und das Scheitern seiner Außenpolitik gegenüber Frankreich (als es 1323 wieder zu Kämpfen kam, konnte Eduard aufgrund der innenpolitischen Lage in England nicht auf den Kontinent übersetzen) wurde ihm jedoch zum Verhängnis.[413]

Eduard III. (1327 bis 1377) gilt in der englischen Forschung als einer der bedeutendsten Herrscher des Mittelalters.[414] In seiner Rolle als „Kriegerkönig“ eröffnete er 1337 den bis 1453 andauernden Hundertjährigen Kriegs mit Frankreich, der bereits ausführlich oben geschildert wurde. Kurz zusammengefasst resultierte dieser Konflikt nicht allein aus konkurrierenden Thronansprüchen gegenüber dem neuen französischen Königshaus, dem Haus Valois, sondern basierte auch auf wirtschaftlichen und politischen Erwägungen (wie dem Status der englischen Besitzungen in Südwestfrankreich). Eduard nahm an vielen Kämpfen aktiv teil. Er setzte dabei mehrmals sein Leben aufs Spiel, so im August 1346 in der Schlacht bei Crécy.[415] der einzigen Schlacht in diesem langen und blutigen Konflikt, in dem sich sowohl der englische als auch der französische König im Kampf gegenüberstanden. Wenngleich die Engländer sehr erfolgreich agierten und 1360 weite Teile gerade des südwestlichen Frankreichs besetzt hielten, verliefen die 1369 erneut ausbrechenden Kämpfe sehr viel ungünstiger.[416] Bei Eduards Tod 1377 hatte sich das Blatt weitgehend zugunsten der Franzosen gewendet, wenngleich die Engländer immer noch Teile ihrer Eroberungen halten konnten.
Innenpolitisch konnte Eduard III. erst ab 1330 selbstständig regieren, nachdem zuvor seine Mutter Isabelle und Roger Mortimer die wahre Macht ausgeübt hatten. 1330 ließ Eduard Mortimer hinrichten und verbannte Isabelle.[417] In der Folgezeit zeichnete sich seine Herrschaft durch eine Verzahnung von Innen- und Außenpolitik aus, wobei er in den 1330er Jahren wieder gegen Schottland vorging.[418] Die sozioökonomischen Folgen der 1348 England erreichenden Pest waren dramatisch, die hohen Todeszahlen wurden begleitet von wirtschaftlichen Problemen, auf die unten näher eingegangen wird. Der lange und kostspielige Krieg in Frankreich belastete des Weiteren die Finanzen extrem. Wiederholt musste Eduard im Parlament um weitere Gelder bitten. Durch die Rolle des Parlaments in Steuerfragen wurde vor allem die Bedeutung der Commons (der Vertreter der Grafschaften und Städte im Parlament) in Politik und Gesetzgebung gestärkt. Doch führten die hohen Kosten zu politischen Widerständen; erschwerend kam hinzu, dass Eduard im Alter an Senilität litt, so dass seine Söhne eine zunehmend größere politische Rolle spielten und teils unterschiedliche Positionen bezogen. Die steigende Verärgerung über die königliche Politik gipfelte 1376 im Good Parliament, als besonders Vertreter der Commons ihre Kritik über hohe Steuerlasten und Korruption äußerten, wobei diese Erklärungen vor allem auf Eduards Sohn John of Gaunt, 1. Duke of Lancaster zielten, der sich immer unbeliebter gemacht hatte.[419] Demgegenüber war das Verhältnis Eduards zu den adeligen Großen weitgehend unproblematisch.
Eduards lange Regierungszeit, seine durchaus vorhandenen Erfolge und seine persönlichen Eigenschaften haben zu einer überaus positiven Beurteilung des Königs geführt, der in der grundlegenden Biographie Ormrods als „tapferer Held und kriegerischer Monarch“ bezeichnet wird, wenngleich keinesfalls als fehlerfreier Herrscher.[420] Eduard präsentierte sich offenbar bewusst als Vertreter des kriegeradligen Ritterideals, wie seine bereits erwähnten Handlungen im Krieg gegen Frankreich, aber auch gegen Schottland belegen.[421] Eduard war politisch sicherlich trotz einzelner Fehlschläge und Fehleinschätzungen ein erfolgreicher Herrscher. Es gelang ihm, die Königsherrschaft zu stabilisieren, in England selbst einen weitgehenden Frieden herzustellen und auf der außenpolitischen Ebene die Stellung Englands zu stärken.[422] Dies alles war aber begleitet von nicht zu übersehenden inneren Problemen im Bereich Finanzen und Wirtschaft, hinzu kamen die Rückschläge im Krieg gegen Frankreich in den 1370er Jahren. Nach seinem Tod im Juni 1377 trat sein Enkel Richard, der Sohn des berühmten „Schwarzen Prinzen“ Eduard, sehr jung die Nachfolge an und wurde bald schon mit den Folgen der innenpolitischen Krisenerscheinungen konfrontiert.
Vom Ende des Hauses Plantagenet zu den Rosenkriegen: 1377 bis 1485

Mit Richard II.[423] (1377 bis 1399) beginnt eine Periode der englischen Geschichte, die von einer Krise des Königtums besonders hinsichtlich der legitimen Nachfolgefrage, die in blutigen Thronkämpfen Ende des 15. Jahrhunderts münden sollte, und der letzten Phase des Hundertjährigen Krieges geprägt ist. Der erste Teil dieser Zeit, vom Tod Eduards III. bis 1422, wurde von Thomas Walsingham in dessen Chronik geschildert, die eine zentrale Quelle und eine der bedeutendsten englischen Chroniken des Spätmittelalters darstellt.[424]
Richards Regierungsantritt erfolgte in einer innenpolitisch schwierigen Zeit. Steuerbelastung, die sozioökonomischen Folgen der Pest und der anschließenden Entwicklung (erhöhte Lohnkosten, Verfall von Grundstückspreisen und Preisverfall bei Getreide) führten zu erheblichen Spannungen zwischen Grundherren bzw. Krone auf der einen und der Masse der ländlichen Bevölkerung auf der anderen Seite. Die Einführung einer neuen Kopfsteuer zur Finanzierung des Kriegs gegen Frankreich im Jahr 1380 brachte das Fass zum Überlaufen und führte im Mai/Juni 1381 zu einem großen Bauernaufstand, bei dem der junge König erheblichen persönlichen Einsatz zeigte und Respekt erwarb.[425] Der Aufstand wurde niedergeschlagen, es setzte aber eine Entwicklung ein, die zu einer Verbesserung der bäuerlichen Wirtschafts- und Lebensverhältnisse führte (siehe unten). In den folgenden Jahren verschlechterte sich das Verhältnis Richards zum Parlament erheblich. Der Krieg mit Frankreich dauerte weiter an, ohne das ein Ende abzusehen war, verschlang aber weiter erhebliche Mittel. Hinzu kam eine beim Parlament missliebige Günstlingsherrschaft des Königs. 1386 kulminierte die Unzufriedenheit mit Ratgebern und Politik des Königs sowie dem ungünstigen Kriegsverlauf im sogenannten Wonderful Parliament, als Ende 1386 neue Steuerforderungen des Königs mit der Forderung nach politischen Reformen durch das Parlament beantwortet wurden. Die Folge dieser Kraftprobe war nicht nur der Sturz von Richards Kanzler (Michael de la Pole, 1. Earl of Suffolk), sondern auch die Einrichtung eines parlamentarischen Gremiums, das die königliche Politik fortan überprüfen sollte.[426] Aus dieser Demütigung des Königs resultierte der folgende Konflikt Richards mit den sogenannten Lords Appellant, die 1387 siegreich waren und den König faktisch zu einer reinen Symbolfigur degradierten. Ebenso erfolgte die Anklage gegen mehrere Ratgeber des Königs im Rahmen des Merciless Parliament von 1388. Doch Richard gewann ab 1389, nicht zuletzt dank seines Onkels John of Gaunt, wieder an Macht. 1396 erfolgte ein mehrjähriger Waffenstillstand mit Frankreich, wodurch der König im Inneren freie Hand gewann. 1397 rächte er sich erbittert an seinen innenpolitischen Gegnern, so dass seine letzten beiden Regierungsjahre in der Geschichtsschreibung als eine Tyrannenherrschaft dargestellt wurden. 1399 wurde Richard von seinem Verwandten Henry Bolingbroke (der Sohn Johns und von Richard verbannt) gestürzt und im September für offiziell abgesetzt erklärt; er starb unter ungeklärten Umständen Anfang des folgenden Jahres, womit das Haus Plantagenet in direkter Linie erlosch.
Richard förderte die Künste und bewies etwa beim Bauernaufstand persönlichen Mut, der Beginn seiner Herrschaft begann mit guten Erwartungen. Schon Zeitgenossen betrachteten ihn zumindest im Rückblick aber als hochmütig, was seinen tiefen Fall bewirkt habe; dies kommt unter anderem beim Chronisten Adam of Usk deutlich zum Ausdruck.[427] Und wenngleich das Andenken Richards nach seinem Sturz (literarisch durch William Shakespeare in seinem frühen Drama Richard II. verarbeitet) systematisch verdunkelt wurde,[428] so ist doch zu erkennen, dass zumindest das Ende seiner Herrschaft als rechtsbrüchig betrachtet wurde.[429] Er erkannte aber auch, dass der lange Krieg mit Frankreich nun, nachdem Erfolge ausblieben und die finanzielle Belastung anhielt, ein Ende haben musste.[430] Im Konflikt mit dem Parlament spielten nicht zu vereinbarende Gegensätze der königlichen Herrschaftsauffassung auf der einen und die Kompetenzausweitung des Parlaments auf der anderen Seite eine zentrale Rolle.[431] Sein Ende schuf ein schwerwiegendes Legitimationsproblem für das neue Königshaus Lancaster und leitete die Krise des englischen Königtums im 15. Jahrhundert ein.
Die Regierungszeit Heinrichs IV. (1399 bis 1413) wurde von den Umständen seiner Thronbesteigung überschattet.[432] Der Dynastiewechsel warf grundsätzliche Fragen auf, denn der Sohn von John of Gaunt war keineswegs der einzige potentielle Thronkandidat. Zu den problematischen Thronansprüchen kamen weitere Schwierigkeiten, die Heinrich aber überwinden konnte. Dazu gehören die walisische Rebellion von Owain Glyndŵr, die 1405 niedergeschlagene Erhebung des mächtigen Henry Percy, 1. Earl of Northumberland und die Verfolgung der christlichen Splittergruppe der Lollarden. Finanziell litt Heinrich unter ständiger Geldnot und hatte ein nicht spannungsfreies Verhältnis zum Parlament, das von ihm eine gute Regierungsführung unter Bewahrung der parlamentarischen Rechte verlangte. 1406 kam es zu einem gesundheitlichen Zusammenbruch des Königs, was die weitere Regierungstätigkeit beeinträchtigte. Im „langen Parlament von 1406“ (long Parliament)[433] gewährte das Parlament dem König nach langen Sitzungswochen zwar beantragte Geldmittel, es verlangte und erhielt aber die Zusage, dass sich der König mehr auf Beratung verlassen würde; in diesem Sinne wurde der Kronrat reformiert. Ebenso wurden die Grundlagen für die Erbnachfolge verbindlich geregelt, um eine Nachfolgekrise zu vermeiden.[434] Die letzten Jahre seiner Regierungszeit sind quellenmäßig eher schlecht belegt, doch ist klar, dass die Herrschaft des Hauses Lancaster nicht unumschränkt akzeptiert wurde und Heinrichs Gesundheitszustand die Lage verkomplizierte. Agierte er zu Beginn energisch und auch skrupellos, so verfügte er in den späteren Jahren nicht mehr über die Kraft, das Königsamt auszufüllen, zumal ihm (trotz der schlechten Beurteilung Richards II.) der Makel des Usurpators anhing. Den Frieden mit Frankreich bewahrte er und bei der Ausübung der Herrschaft bemühte er sich wieder stärker um Konsens.[435]
England und der Kontinent: Die auswärtige Politik der englischen Könige
Die englisch-französischen Beziehungen gestalteten sich vom 12. Jahrhundert bis zum Ausgang des Spätmittelalters als schwierig.[436] Am Ende des Hochmittelalters war das angevinische Reich von Haus Plantagenet zusammengebrochen, nachdem es den französischen Königen gelungen war, die Engländer zunächst militärisch zu schlagen (Schlacht von Bouvines 1214), in der Folgezeit weitere Gebiete zu erobern und schließlich den englischen König Heinrich III. zum Vertrag von Paris (1259) zu zwingen.[437] Der zuvor beachtliche Festlandsbesitz der Plantagenets schmolz damit auf Ländereien im Südwesten dahin, die Guyenne (Gascogne), für die die englischen Könige fortan dem französischen König die Lehnstreue schuldeten. Diese Regelung erwies sich allerdings, wie die Entwicklung bereits Ende des 13. Jahrhunderts zeigte, als nicht langfristig tragfähig. Denn die grundsätzliche Vorstellung, dass der englische König einen anderen Monarchen für zumindest einen Teil seines Herrschaftsraums als übergeordnet anerkennen musste, war problematisch, da so weiterhin französische Interventionen in der Guyenne drohten. Die Guyenne mit dem Hafen von Bourdeaux war für die englischen Könige aufgrund des profitablen Weinhandels von wirtschaftlicher Bedeutung. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts wurden dort 80.000 Tonnen Wein jährlich verschifft, davon mindestens ein Viertel nach England.[438] Wenngleich die englischen Könige selbst die Region kaum besuchten, war sie verwaltungstechnisch direkt der Krone unterstellt (mit einem Seneschall der Gascogne) und stellte außerdem strategisch eine bedeutende Besitzung dar.[439] Der Status der Guyenne bot somit weiterhin Konfliktstoff.[440]

Im Vertrag von Amiens (1279) war noch einmal eine Übereinkunft erzielt worden, doch von 1294 bis 1297/98 kam es aufgrund der steigenden Spannungen zu offenen Kampfhandlungen.[441] Auslöser war ein lokaler Streit, nachdem englische Behörden französische Seeleute festgesetzt hatten, die eigentliche Ursache war aber der Status der Guyenne. Philipp IV. beabsichtigte offenbar, seinen Oberherrschaftsanspruch nun durchzusetzen und damit seine königliche Autorität hervorzuheben, weshalb er den englischen König Eduard I. in dessen Eigenschaft als Lehnsträger im Oktober 1293 vorlud. Die Vorladung offenbarte das grundsätzliche Problem des hierarchischen Verhältnisses zwischen dem König von Frankreich als Lehnsherr und dem englischen König als Lehnsnehmer für die Guyenne. In diesem Zusammenhang beanspruchte Philipp die oberste Rechtsprechung; da Eduards Amtsträger aber Recht gebrochen hatten, nutzte Philipp dies zur Durchsetzung seines Herrschaftsanspruchs.[442] Philipp zog das Lehen schließlich ein und es kam zum Krieg.
In dem folgenden Konflikt, der sich für Eduard als kostspielig erwies, war sogar der römisch-deutsche König Adolf von Nassau involviert, der sich mit Eduard verbündete und dafür Gelder erhielt, aber kaum eingriff.[443] Im Südwesten erfolgte auf erste englische Erfolge 1294 ein starker französischer Gegenschlag mit weiteren Kämpfen in den folgenden Monaten. Flandern sollte den Engländer als Aufmarschgebiet dienen, doch kam ein erhofftes Bündnis zunächst nicht zustande und wurde erst Anfang 1297 abgeschlossen, wobei sich der Graf von Flandern selbst ebenfalls im Konflikt mit Philipp befand.[444] Im August 1297 landete Eduard in Flandern, doch die Lage entwickelte sich ungünstig, so dass beide Könige im Oktober 1297 einen Waffenstillstand schlossen. 1299 heiratete Eduard zwar Philipps Tochter Magarethe und 1303 wurde ein Friedensvertrag unterzeichnet.[445] Das grundsätzliche Problem im Hinblick auf den Status der Guyenne und der Lehnsoberherrschaft war damit aber immer noch nicht gelöst.

Dies war einer der Auslöser des Hundertjährigen Krieges von 1337 bis 1453, der bereits oben geschildert wurde.[446] Nach dem Aussterben der Kapetinger in direkter Linie trat das Haus Valois die Nachfolge an. Politische und wirtschaftliche Konflikte führten 1337 zum Kriegsausbruch, wobei der englische König Eduard III. seinen konkurrierenden Thronanspruch erst 1340 offen geltend machte. Der Krieg verlief in mehreren Phasen und wurde immer wieder von Waffenstillständen unterbrochen. Während die Engländer zunächst sehr erfolgreich waren und um 1360 den Südwesten und Teile des Nordens Frankreichs kontrollierten, waren die Franzosen in den Kämpfen der 1370er Jahre siegreich, so dass es 1396 zu einem vorläufigen Ende der Kämpfe kam. 1415 nutzte jedoch Heinrich V. die inneren Konflikte in Frankreich für eine Invasion (siehe ebenfalls die Ausführungen oben). Nach dem grandiosen Sieg in der Schlacht von Azincourt kontrollierten die Engländer im Anschluss an den Vertrag von Troyes einen Großteil des Landes, bevor ab 1429 die Franzosen zum Gegenschlag übergingen. Als dann noch 1435 das (seit 1420 bestehende) Bündnis mit Haus Burgund zerbrach, erwiesen sich die Eroberungen als unhaltbar.[447] England verlor bis 1453 alle Festlandsbesitzungen (einschließlich der Guyenne) und vermochte nur Calais bis 1558 zu behalten.[448] Dies war das faktische Ende der englischen Herrschaft auf dem Kontinent, wenngleich sich noch die Tudorherrscher teils versuchten einzumischen, es blieb aber hier bei vereinzelten und begrenzten Interventionen.[449]
Zwischen England und dem römisch-deutschen Reich bestanden im Spätmittelalter wirtschaftliche Verflechtungen, doch gab es auch immer wieder Versuche einer näheren politischen Zusammenarbeit.[450] Diese fanden vor allem im Kontext der englisch-französischen Auseinandersetzungen statt. Nach dem erwähnten Bündnisplan Eduards I. mit Adolf von Nassau bestand denn auch einige Zeit eine „Reichsferne“ des englischen Königtums, nachdem der Konflikt abgeebbt war. Dies änderte sich in der Regierungszeit Eduards III., der bestrebt war, beim Ausbruch des Hundertjährigen Krieges den römisch-deutschen Kaiser Ludwig IV. und/oder Reichsfürsten für sich zu gewinnen.[451] Dies brachte allerdings nicht den erhofften Erfolg, zumal Ludwig eine Schaukelpolitik betrieb. Karl IV. hingegen war frankreichfreundlich eingestellt, ein dennoch 1348 abgeschlossenes Bündnis zwischen England und dem Reich schloss daher ausdrücklich jede Unterstützung gegen Frankreich aus; im Dezember 1356 verständigten sich sogar der Kaiser und Frankreich in einem Vertrag.[452] Unter Sigismund gab es wieder engere Beziehungen, da der zukünftige Kaiser das Schisma beenden wollte und sein Verhältnis zu Frankreich zeitweise angespannt war. Ein englisch-luxemburgisches Bündnis (Vertrag von Canterbury (1416)) war jedoch nicht von Dauer,[453] in den 1430er Jahren wandte sich Sigismund wieder Frankreich zu.
Innere Entwicklung
Königsherrschaft mit Parlament
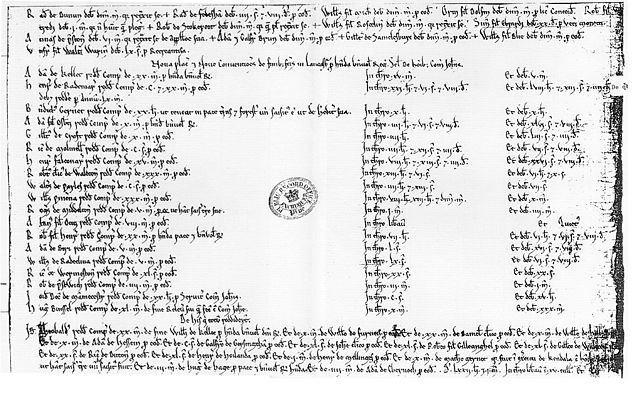
Zentrum der Königsherrschaft war der Hof in London. Mit der normannischen Eroberung Englands 1066 etablierte sich eine relativ starke königliche Zentralgewalt in England. Dies wurde ermöglicht durch eine verhältnismäßig gute Verwaltungsstruktur mit lokalen Amtsträgern.[454] Eine zentrale Rolle spielte hierbei die schriftliche Verwaltungsführung.[455] Seit dem Doomesday Book (Ende des 11. Jahrhunderts) erfassten die englischen Könige systematisch die Besitzverhältnisse in ihrem Reich, woraus sich die zu entrichtenden Abgaben ergaben.[456] Seit dem 12. Jahrhundert sind die entsprechenden Steuerunterlagen (Pipe Rolls) überliefert, für die zentrale königliche Finanzverwaltung war ab der Zeit Heinrichs I. der Schatzkanzler (Exchequer) zuständig. Seit 1199 wurden in der königlichen Kanzlei ausgestellte Urkunden und Briefe protokolliert, beginnend mit den Charter Rolls und kurz darauf gefolgt von Close Rolls und Patent Rolls (siehe Letters Patent).[457] Die dokumentarische Quellenlage ist somit in England bereits seit dem Hochmittelalter deutlich besser als etwa für das römisch-deutsche Reich.[458]
Verwaltungstechnisch war das Land in Grafschaften eingeteilt, wobei der Sheriff als lokaler königlicher Vogt diente und für Steuererhebung, Strafverfolgung und Gerichtsbarkeit zuständig war.[459] Im Spätmittelalter erfolgte eine weitere Verdichtung der Königsherrschaft.[460] Eduard I. sorgte für eine neue Volkszählung, die dann die Grundlage für die sogenannten Hundred Rolls bildete. Im 14. Jahrhundert wandelten sich die Aufgaben der Sheriffs, die einen Teil abgaben, aber vor allem im rechtlichen Bereich verstärkt tätig waren, was eine vermehrte Schriftführung zur Folge hatte. Auf lokaler Ebene genossen sie große Autonomie, hinzu kamen unter anderem Beauftragte für den Einzug heimgefallener Lehen und Friedensrichter.[461] Die Aktenführung, bereits vorher essentiell für die Verwaltungsaufgaben, wurde immer umfangreicher, was sich an den Finanz- und Kanzleiregistern ablesen lässt. Mitte des 14. Jahrhunderts wurden wohl bis zu 50.000 Schriftstücke im Jahr von der königlichen Zentralverwaltung verfasst, wobei sie stets Kopien behielt; dasselbe galt für die Gerichte.[462] Die beiden wichtigsten Behörden am Hof waren der Exchequer (die Behörde war geteilt in zwei Abteilungen) und die Kanzlei (Chancery), wobei der Exchequer auch die Amtsführung der Sheriffs anhand der Akten prüfte und die Kanzlei unverzichtbar für den zwingend notwendigen Schriftverkehr war.[463] Die Calendars der Close Rolls und Patent Rolls, Zusammenfassungen dieser Kanzleiregister in englischer Übersetzung, sind für das 14. und 15. Jahrhundert verfügbar und online weitgehend frei einsehbar.[464] Kirche und Königtum kooperierten in vielfacher Weise, so dass mehrere Bischöfe im königlichen Dienst aktiv waren und der König andererseits die Besetzung von Bischofsämtern beeinflussen konnte.[465]

Grundsätzlich war die politische Stellung des Königtums vergleichsweise stark, der König war lehnsrechtlich Herr des gesamten Landes; die mächtigen Barone entwickelten nie ein partikulares Gegengewicht zum König, wie dies bei den Landesherren im römisch-deutschen Reich der Fall war. Seit der Magna Carta von 1215 ergaben sich aber Beschränkungen der königlichen Politik; aus der Curia Regis entwickelte sich im 13. Jahrhundert schrittweise das Parliamentum, das neben Baronen und Kirchenvertretern bald auch Vertreter der Städte und der Grafschaften umfasste, die seit dem frühen 14. Jahrhundert ständig vom König zur Versammlung geladen wurden. Diese Einrichtung darf nicht mit dem heutigen Parlament verwechselt werden, doch nahm die moderne Entwicklung im Spätmittelalter ihren Anfang.[466] Zentrale Bedeutung hatten im Parlament Gesetzgebung, Finanzfragen und Petitionen, die die Grundlage für Gesetzesbeschlüsse bildeten.[467] Dies war der Ort, wo die Gesetzgebung des Königs an die Zustimmung der Vertreter seiner Untertanen geknüpft war, wobei Steuerbewilligung und Mitwirkung an der Gesetzgebung mächtige Hebel waren. Im späten 14. und dann im 15. Jahrhundert waren jährliche Zusammenkünfte die Regel, das Parlament war nun fest in die königliche Herrschaftspraxis eingebunden und wurde speziell im Hinblick auf die Kriegsfinanzierung benötigt, wenn neue Steuern erhoben werden mussten.[468] Dennoch spielte der König bei diesen Zusammenkünften eine wichtige Rolle, ohne ihn konnte kein Parlament tagen und er konnte es auch auflösen. Die Vertretung bestand aus zunächst gemeinsam tagenden Teilen, den Lords, also dem Hochadel und hohen Klerus (in der Zeit um 1400 rund 100 Männer, wovon nicht alle teilnahmen), und den Commons als Vertreter der Grafschaften und Städte.[469] Mitte des 14. Jahrhunderts spaltete sich das Parlament in zwei Kammern auf: Dem House of Lords und dem House of Commons.[470] Bei den Commons rekrutierten sich die Vertreter der Grafschaften (Knights of the Shire) aus einem kleinen Kreis meist gut vernetzter Grundbesitzer, die seit dem späten 14. Jahrhundert auf Versammlungen gewählt wurden; zu den Vertretern der größeren Städte zählten oft reiche Kaufleute. Die Vertreter aus dem Süden überwogen dabei.
Um 1400 dienten die Lords als Hauptansprechpartner des Königs in Fragen der Kriegs- und Außenpolitik, während die Commons im Gesetzgebungsprozess oft die Initiative übernahmen.[471] Das Mitspracherecht des Parlaments bei Steuerfragen engte den fiskalischen Spielraum des Königs empfindlich ein, was sich während des Hundertjährigen Krieges in der gewachsenen politischen Stellung des Parlaments und speziell der Commons ausdrückte.[472] In manchen Situationen konnten die Commons auch ihre Interessen artikulieren, so 1376 (Gutes Parlament), als Geldverschwendung während des Kriegs mit Frankreich angeprangert wurde.[473] Diese Entwicklung führte dazu, dass ab 1406 jedes Finanzgesetz zuerst den Commons vorgelegt werden musste und 1489 ein Gerichtsurteil festlegte, dass nur vom König und beiden Kammern des Parlaments gemeinsam beschlossene Gesetze Gültigkeit hatten.[474] Demgegenüber beriet sich der König mit Vertrauten im Kronrat, dem Council, der auch die Regierungsgeschäfte führte, wenn der König dazu nicht in der Lage war, wie bei Krankheit oder Minderjährigkeit.[475] Die spätmittelalterliche Königsherrschaft unterschied sich durch die veränderten Rahmenbedingungen, wie der Rolle des Parlament, somit deutlich von der etwa im 12. Jahrhundert, ebenso entwickelte sich die Verwaltung weiter.[476]
Die Kompetenzen der königlichen Gerichte wurden stetig erweitert und stärker in Anspruch genommen, was gemeinsam mit der Gesetzgebung eine Verdichtung der Königsmacht bedeutete und für den weiteren staatlichen Entwicklungsprozess Englands bedeutsam war.[477] Die steigende Gerichtstätigkeit führte außerdem zur Entstehung des sogenannten Common Law, der Ableitung bestimmter Rechtsgrundsätze auf Grundlage von Präzedenzfällen königlicher Gerichte. Diese Entwicklung ist neben der Etablierung des Parlaments ein wesentliches Kennzeichen für die Herausbildung einer spezifisch englischen Identität im Spätmittelalter. Geoffrey Chaucer übte kulturell großen Einfluss auf die folgende englisch-höfische Literaturgeschichte im Rahmen der „Anglisierung“ der Gesellschaft aus, nachdem die französische Literatur zuvor dominierendes Vorbild war.[478]
In finanzieller Hinsicht war die Lage des Königs nicht selten angespannt.[479] Der lange Krieg mit Frankreich verschlang Unsummen und die Einkünfte (wie aus Grundbesitz und Regalien) konnten das nicht decken, so dass die spätmittelalterlichen englischen Herrscher oft neue Steuern erheben (wozu, wie bereits erwähnt, das Parlament benötigt wurde) oder Kredite (wie bei italienischen Bankiers) aufnehmen mussten. Die Kreditaufnahme behob zwar das kurzfristige Liquiditätsproblem, führte aber zu einer teils hohen Verschuldung einzelner Herrscher, wie oben das Beispiel Eduards I. zeigt, der seinem Sohn Eduard II. Schulden in Höhe von rund 200.000 Pfund hinterließ[480] – was geschätzt in etwa einem Fünftel der gesamten im Umlauf befindlichen Geldmenge im Königreich entsprochen haben dürfte.[481] Steuern spielten eine immer wichtigere Rolle zur Staatsfinanzierung, hinzu kamen Zölle, die aber den Handel beeinträchtigten, was gerade den wichtigen englischen Wollhandel hart traf.[482]
England nach der Pest: Eine Gesellschaft im Wandel

Um 1300 lebten in England rund fünf Millionen Menschen, doch aufgrund der Hungersnot von 1315–1317 und dann vor allem dem Ausbruch der Pest 1348[483] sank diese Zahl dramatisch, ein Drittel bis die Hälfte der Bevölkerung starb.[484] Hinzu kamen die klimatische Verschlechterung, weitere Krankheitswellen und wohl ein Geburtenrückgang;[485] am Ende des 14. Jahrhunderts mögen nur noch rund 2,3 Millionen Menschen in England gelebt haben.[486]
Dies hatte zahlreiche sozioökonomische Folgen.[487] Eine davon war, dass die geringere Bevölkerung leichter versorgt werden konnte sowie sich das Arbeits- und Sozialgefüge durch den Bevölkerungsrückgang veränderte.[488] Ein massiver Arbeitskräftemangel setzte ein, der noch bis ins späte 15. Jahrhundert andauern sollte, was steigende Löhne und fallende Preise bewirkte.[489] Anbau und landwirtschaftliche Produktion veränderten sich ebenfalls, so wurde teils Landbewirtschaftung aufgegeben, woanders erfolgte oft der Wechsel hin zur Weidewirtschaft mit Schafen. Mehrere durch die Pest bereits entvölkerte Dörfer wurden aufgegeben, als die verbliebene Bevölkerung sich nach besseren Gelegenheiten umsah.[490] Ebenso eröffneten sich neue Aufstiegschancen, wie bei der Vergabe neuer Kirchenämter, durch Landerwerb (Aufstieg in den niederen Adel) und Handel. Insgesamt stieg die soziale Mobilität,[491] was aber freilich nicht für die meisten Menschen galt.[492] Dennoch konnten sich nun beispielsweise kleinere Bauern durch den Wertverfall von Grundstücken größere Höfe leisten.[493]

Grund und Boden verloren durch die Pestfolgen drastisch an Wert, was die Großgrundbesitzer traf und andererseits den Wert der bäuerlichen Arbeitskraft schlagartig erhöhte; dies galt sowohl für gelernte als auch ungelernte Arbeitskräfte, während gleichzeitig der Getreidepreis fiel.[494] Die Bauern befanden sich damit gegenüber den Lords in einer weitaus besseren Position als zuvor. In der Zeit nach der Pest waren es die gestiegenen Lohnkosten, die für die reichen Grundbesitzer am kostspieligsten waren, nicht etwa geringere Einkünfte.[495] Die königliche Regierung reagierte darauf, als im Statute of Labourers von 1351 unter anderem Preise und Löhne auf den Stand vor Ausbruch der Pest eingefroren wurden.[496] Der in dieser Form erstmalige staatliche Eingriff scheint wenig genutzt zu haben und war aufgrund der knappen Arbeitskräfte nicht realistisch umsetzbar.[497] Ende des 14. Jahrhunderts waren die Löhne trotzdem gestiegen, während die Preise für Agrarprodukte fielen. Die Folge war ein zunehmender Druck der Lords auf die Bauern hinsichtlich von Dienst- und Abgabenpflichten (so eine Bindung der Arbeiter an den Arbeitsort, um Abwanderungen zu verhindern), wogegen diese sich wehrten. Verschlimmernd kam die Geldnot des Königtums aufgrund des Kriegs gegen Frankreich hinzu,[498] weshalb das Parlament eine neue Kopfsteuer (poll tax) genehmigt hatte, was den Steuerdruck erhöhte. Die Spannungen stiegen zusätzlich durch die Verbreitung der sozialrevolutionären Lehren John Wyclifs. Eine lokale Erhebung gegen Steuereintreiber in Essex führte dann am 30. Mai 1381[499] zum großen Bauernaufstand von 1381 (Peasants' Revolt). Der Aufstand, an dem sich nicht nur einfache Bauern, sondern auch Handwerker und andere Gruppen beteiligten, erschütterte das Königreich. Er richtete sich im Kern sowohl gegen die Krone als auch gegen das Verhalten der reichen Grundbesitzer.[500] Die Aufständischen zogen sogar gegen London, wo der sehr junge König Richard II. sich bereit erklärte, zu verhandeln. Bei einer folgenden Unterredung wurde einer der Rebellenführer, ein ehemaliger Soldat namens Wat Tyler, im Juni 1381 im Beisein des Königs getötet. Die Erhebung wurde nun rasch niedergeschlagen, eine neue Kopfsteuer wurde jedoch nicht mehr vom Parlament genehmigt.[501]
Der weiterhin fallende Getreidepreis und die verursachten Kosten sorgten für eine umwälzende Veränderung in der englischen Agrargesellschaft. Viehhaltung erwies sich als kosteneffizienter und die Bewirtschaftung grundherrlicher Güter als zunehmend unprofitabel.[502] Eine Folge des Aufstands und der folgenden Entwicklung war eine Besserstellung der Bauern in der Folgezeit, sowohl in rechtlicher als auch in wirtschaftlicher Hinsicht.[503] Statt Dienstpflichten zu leisten wurden sie zu Pächtern mit erhöhter Mobilität, da sie nicht mehr zu Arbeitspflichten an einen Ort gebunden waren. Viele Grundherren gaben die unrentable Eigenbewirtschaftung auf und verpachteten Güter an Bauern, wobei viele Bauern hierbei insgesamt günstiger gestellt wurden und sich ihre Lebensbedingungen verbesserten. Ihre rechtliche Stellung verbesserte sich ebenfalls weiter und im 15. Jahrhundert sind zunehmend wohlhabende Bauernfamilien belegt; die Folge war die Etablierung einer „Bauernaristokratie“ (peasant aristocracy, siehe Yeoman).[504] Die traditionelle Verbindung von Landbesitz und Status wurde so durch die Pest und ihre Folgen aufgebrochen.[505]
Neben der Landwirtschaft war ein Kernelement des Wirtschaftssystems im spätmittelalterlichen England der Export von Wolle (vor allem nach Flandern) und später fertiger Textilwaren auf den Kontinent, wovon vor allem die Londoner Kaufleute profitierten.[506] Dies hing mit der Umstellung auf die Weidewirtschaft mit Schafen zusammen. Es entwickelte sich daneben aber auch ein produzierendes Gewerbe, so dass sich der Schwerpunkt von Wollausfuhren zu fertigen Textilprodukten verschob. Englisches Tuch wurde auf Messen unter anderem von oberdeutschen Kaufleuten viel eingekauft. Eine Störung des Textilhandels konnte so fatale Folgen haben. Daneben wurden nur wenige andere Güter exportiert, wohingegen eine Vielzahl von Waren importiert wurde, darunter nicht zuletzt Wein aus der Guyenne. Eine Schlüsselrolle im Handel spielten die Städte, die weitaus größte Stadt blieb (mit deutlich reduzierter Bevölkerung von zuvor ca. 80.000 Menschen) London.[507] Wenngleich die Urbanisierung zunahm, war das spätmittelalterliche England geprägt von (im europäischen Vergleich) deutlich kleineren Städten.[508] Der Warenaustausch mit dem ländlichen Raum blieb weiterhin ein wichtiger Faktor.
Italien
In Italien profitierten im 13. Jahrhundert lokale Machthaber der Ghibellinen und Guelfen vom Rückgang der Reichsherrschaft. Während die Ghibellinen sich im Regelfall mehr auf den Adel stützten, wies das Guelfentum eine gewisse Nähe zum „Republikanismus“ auf und wurde von der Kirche, Frankreich und den Anjous im Kampf gegen die Herrschaft der römisch-deutschen Könige unterstützt: Im Wortgebrauch der guelfischen Florentiner war „Ghibelline“ etwa synonym mit „Alleinherrscher“. Hauptsächlich dienten die Begriffe aber der Bezeichnung konkurrierender Stadtparteien.
Florenz und Venedig wuchsen durch Finanzgeschäfte und Handel zu mächtigen Stadtrepubliken heran, welche die politischen Hauptakteure in der Toskana und im Norden waren. Die in Florenz seit 1434 vorherrschende Familie der Medici förderte die Künste und wurde dadurch eine Triebkraft der Renaissance. Mit der Rückkehr des Papsttums nach Rom 1378 wurde diese Stadt ein weiteres Mal politische und kulturelle Metropole. Der Italienzug Heinrichs VII. (1310–13) stellte den letzten ernsthaften Versuch dar, den Reichsrechten in Reichsitalien wieder Geltung zu verschaffen, womit Heinrich aber, auch bedingt durch seinen frühen Tod, scheiterte. Ludwig der Bayer und Karl IV. wurden in Italien, von ihren Italienzügen abgesehen, kaum aktiv, während Ruprecht von der Pfalz von Gian Galeazzo Visconti an den Alpen blutig abgeschlagen wurde. Der Frieden von Lodi von 1454 mit der Vollform der italienischen lega universale gilt bereits als Ereignis der Renaissance, der Übergangszeit zur Neuzeit. Politisch war Italien nach dem Neapelfeldzug Karls VIII. erschüttert. Dies markierte den Beginn der sich bis ins 16. Jahrhundert hinziehenden Kriege um die Hegemonie in Italien und das endgültige Ende des Mittelalters in dieser Region.
Iberische Halbinsel
1469 heirateten Isabella von Kastilien und Ferdinand II. von Aragon und bildeten damit das Territorium des modernen Spanien. 1492 wurden die Mauren von Granada vertrieben, die Reconquista (Rückeroberung) war damit abgeschlossen. Portugal hatte während des 15. Jahrhunderts langsam die Küste Afrikas erforscht und 1498 fand Vasco da Gama den Seeweg nach Indien. Die spanischen Herrscher begegneten dieser Herausforderung, indem sie Kolumbus’ Expedition unterstützten, der einen westlichen Seeweg nach Indien suchte. Er entdeckte Amerika im selben Jahr, in dem Granada fiel.
Skandinavien
Nach dem Scheitern der Union zwischen Schweden und Norwegen (1319–1365) wurde 1397 die skandinavische Kalmarer Union gegründet. Die Schweden zögerten, sich an der dänisch dominierten Union zu beteiligen, und traten nach dem Stockholmer Blutbad 1520 aus. Norwegen andererseits verlor seinen Einfluss und blieb mit Dänemark bis 1814 vereinigt. Die norwegische Kolonie auf Grönland ging im 15. Jahrhundert unter, vermutlich aufgrund der sich verschlechternden klimatischen Bedingungen.
Osteuropa
Im Norden bestand die wesentliche Entwicklung jener Jahre im enormen Wachstum des litauischen und dann polnisch-litauischen Königreichs. Weit im Osten verlor die Goldene Horde 1380 die Schlacht auf dem Kulikowo Pole (Schnepfenfeld) und musste die Vorherrschaft des Großfürstentums Moskau als Regionalmacht anerkennen, der auch die niedergehende Kiewer Rus weichen musste. 1480 beendete Iwan der Große nach dem Stehen an der Ugra endgültig die mongolische Herrschaft in Russland und legte die Grundlagen des russischen Nationalstaates.
Südosteuropa
Das Byzantinische Reich hatte Südosteuropa politisch und kulturell über Jahrhunderte dominiert. Von der Eroberung der Hauptstadt im Jahr 1204, die erst 1261 zurückgewonnen werden konnte, hatte sich das Reich allerdings nie ganz erholt, und die Dynastie der Palaiologen vermochte den Niedergang nicht aufzuhalten. Schon vor dem Fall Konstantinopels 1453 war es zu einem tributpflichtigen Vasallen des Osmanischen Reichs herabgesunken, nur noch bestehend aus der Stadt Konstantinopel und einigen griechischen Enklaven.
Nach dem Fall Konstantinopels standen die von ihm einst beherrschten Teile Südosteuropas fest unter türkischer Kontrolle und blieben es bis zur gescheiterten zweiten türkischen Belagerung Wiens 1683 und der Schlacht am Kahlenberg. Für die Griechen begann eine bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts andauernde Fremdherrschaft, in der nur die orthodoxe Kirche als Bezugspunkt bestehen blieb. Auch die übrigen Balkanländer wie Bosnien, Kroatien, Serbien, Albanien (siehe Skanderbeg) und Bulgarien wurden Teil des Osmanischen Reiches.
Als die Osmanen im Jahr 1453 Konstantinopel eroberten, rief Papst Calixt III. die Christenheit zum Kreuzzug auf. Im christlichen Heer, das im Jahr 1456 das osmanische Heer in der Schlacht bei Belgrad besiegte, befand sich auch eine große Zahl an Kroaten, die der Franziskaner Johannes von Kapistran anführte. Im Jahr 1519 bezeichnete Papst Leo X. die Kroaten anerkennend als Antemurale Christianitatis (lat. „Bollwerk der Christenheit“, wörtlich „Vormauer“), weil sie gegen die Ausbreitung des Osmanischen Reiches gen Europa Widerstand leisteten. Nachdem das christliche Heer von den Türken in der Schlacht bei Mohács im Jahre 1526 aufgerieben worden war, kam auch das Königreich Ungarn unter osmanische Fremdherrschaft, und die Osmanen bedrohten nunmehr auch das übrige Europa. Das Ergebnis der Verteidigungsbemühungen der Kroaten im 15. Jahrhundert waren 30 Kriegszüge und 70 zerstörte Städte.
Remove ads
Gesellschaft und Wirtschaft
Zusammenfassung
Kontext

Das Spätmittelalter war (wie seit dem Frühmittelalter) eine Standesgesellschaft, mit Klerus und Adel an der Spitze, gefolgt von den Bauern und Bürgern. Die Grundherrschaft wandelte sich, doch blieb das Prinzip grundsätzlicher sozialer Ungleichheit (wie auch ansonsten in der vormodernen Gesellschaft Europas) bestehen. Das hierarchisch gegliederte Lehnswesen war weiterhin das bestimmende politisch-gesellschaftliche System und diente der herrschaftlich-rechtlichen Strukturierung.
Im Spätmittelalter nahm die Bedeutung des Fernhandels und der Geldwirtschaft zu. In Oberitalien entstanden die ersten banche, die Stuben der italienischen Geldwechsler und Kreditverleiher, schließlich die großen Handelskompanien – Gesellschaften, die internationalen Handel und Produktion im großen Stil finanzierten, und dafür vom Staat oftmals besondere Privilegien und Monopole erhielten. Die größten Finanziers bezahlten sogar die Kriege der Herrschenden. Familien wie die deutschen Fugger, die italienischen Medici und die de la Poles in England erreichten enorme politische und wirtschaftliche Macht. Der Fernhandel über See (in Nord- und Ostsee sowie im Mittelmeerraum) blühte auf. Vor allem Genua und Venedig verdankten ihren Aufstieg dem blühenden Ost-West-Handel. Neue Fertigungsmethoden verbreiteten sich, vor allem bei Stoffen, Geweben und Metallen.
Die Nachfrage wurde durch die Entstehung von spezialisierten Märkten und Messen angekurbelt. Die Lehnsherren sorgten für einen reibungslosen Ablauf dieser Veranstaltungen, sie bewahrten den Marktfrieden und erhielten Einnahmen aus Zöllen und Handelssteuern. Besonders bekannt waren die jährlichen Champagnemessen in der französischen Champagne. Händler aus ganz Europa und dem Nahen Osten zogen von Ort zu Ort, kauften und verkauften und schufen ein Handelsnetz bis nach Schottland und Skandinavien. Indem sich die Händler vereinigten, um ihre Waren in größeren Handelszügen sicherer durch die Lande zu transportieren, bekamen sie auch mehr Einfluss, z. B. wenn es darum ging, Preise und billigere Wegezölle zu vereinbaren. Die mächtigste Gemeinschaft von Handelspartnern, die von ähnlichen Interessen geleitet waren, stellte die Hanse dar. Im 15. Jahrhundert nahm die Bedeutung der Champagnemessen für den Nord-Süd-Handel ab. Stattdessen wurde der Seeweg zwischen Flandern und Italien bevorzugt. Ferner begannen mehr und mehr englische Wollhändler, zum Schaden der niderländischenn Tuchmanufakturen, statt Wolle nun Kleidung zu exportieren. Entscheidend war auch die Behinderung des Handels mit der Levante durch den Wechsel vom Byzantinischen zum Osmanischen Reich. Alternative Handelswege mussten eröffnet werden – um die Südspitze Afrikas herum nach Indien und über den Atlantik nach Amerika.
Diese Veränderungen förderten auch die Gründung und das Wachstum der Städte. Mit dem Aufblühen der Handelsbeziehungen folgte auch bald das Erfordernis neuer Handelsplätze und die Gründung neuer Städte an den Handels- und Transportwegen. Von etwa 1100 bis 1250 verzehnfachte sich die Zahl der Stadtrechte in Europa, eine Entwicklung, die sich im Spätmittelalter zunächst fortsetzte, dann aber durch die demographische Katastrophe infolge der Pest unterbrochen wurde. Städte wie Innsbruck, Frankfurt, Hamburg, Brügge, Gent und Oxford nahmen erst jetzt einen Aufschwung. Eine kleine Stadt zählte meist rund 2500 Einwohner, eine bedeutende Stadt rund 20.000. Heutige Millionenstädte wie London und Genua brachten es auf 50.000 Einwohner. Die größten Metropolen mit etwa 100.000 Einwohnern waren Paris, Venedig und Mailand.
Remove ads
Bildung und Universitäten
Zusammenfassung
Kontext

Im frühen und hohen Mittelalter war elementare Bildung, wie Lesen, Schreiben und Rechnen, nur einem kleinen Kreis von Menschen zugänglich. Die breite Masse des Volkes, selbst der Adel, besaß kaum oder nur sehr geringe Bildung. Lediglich in den Klosterschulen war es möglich, sich Bildung anzueignen, doch nur für jene, die bereit waren, sich dem Dienst im Orden zu verpflichten. Ab etwa dem Jahr 1000 entstanden, parallel zum Aufblühen der Städte, sogenannte Kathedralschulen. Sie bildeten auch Adels- und Bürgersöhne, ja sogar Leibeigene aus, ohne sie dem Ordensleben zu unterwerfen. Die Kathedralschulen, die sich besonders stark in Frankreich entwickelten, beschränkten den Unterrichtsstoff auf die sieben „freien Künste“, deren Erlernen schon im alten Rom für freie Bürger charakteristisch war, das Trivium (Grammatik, Logik, Rhetorik) und das Quadrivium (Arithmetik, Astronomie, Geometrie, Musik). Gelesen wurden nur wenige anerkannte Schriftsteller der Spätantike und des frühen Mittelalters wie Boëthius, Cassiodor oder Isidor von Sevilla.
Mit den Kreuzzügen bekam das christliche Abendland Kontakt zur Geisteswelt des Islams. Viele bildungshungrige Europäer lernten arabische Mathematik, Astronomie, Medizin und Philosophie kennen, in den Bibliotheken des Orients lasen sie erstmals die griechischen Klassiker wie Aristoteles (im Mittelalter sehr häufig „der Philosoph“ genannt) im Originaltext. Auch über den islamisch besetzten Teil Spaniens kamen viele Impulse besonders nach Frankreich. Das damals vorbildliche Ausbildungssystem der islamischen Welt wurde bereitwillig aufgenommen. Die Regelungen und Lehrpläne der europäischen Kloster- und Kathedralschulen taten sich mit der Integration der neuen Inhalte schwer.
Obwohl Anfang des 12. Jahrhunderts Petrus Abaelardus als einer der Vorreiter dieser Entwicklung noch kirchlicher Verfolgung besonders durch Bernhard von Clairvaux ausgesetzt war, ließ sich die Entstehung von freien Universitäten nicht mehr verhindern. Mit dem Wachstum der erfolgreichen Handelsmetropolen entstanden ab der Mitte des 13. Jahrhunderts auch die Universitäten: Bologna, Padua, Paris, Orléans, Montpellier, Cambridge und Oxford, um nur einige Gründungen dieser Zeit zu nennen. Schon bald gehörte es für eine reiche Stadt zum guten Ton, bekannte Gelehrte und viele Studenten in ihren Mauern zu beherbergen. Im 14./15. Jahrhundert wurden dann auch in Deutschland erste Universitäten gegründet, darunter Heidelberg, Leipzig und Rostock.
Die frühen Universitäten des Spätmittelalters besaßen keine festen Gebäude oder Vorlesungsräume. Je nach Situation nutzte man öffentliche Räume für Vorlesungen: In Italien waren es oft die Stadtplätze, in Frankreich Kreuzgänge in Kirchen und in England fanden die Vorlesungen nicht selten an Straßenecken statt. Erst später mieteten erfolgreiche Lehrer, die von ihren Studenten direkt je Vorlesung bezahlt wurden, Räumlichkeiten für ihre Vorlesungen. Und bald gab es schon die ersten Studentenunruhen: Auch wenn eine Universität der Stolz einer Stadt war, gab es doch häufig Streitigkeiten mit den in Bünden organisierten Studenten wegen zu hoher Preise für Kost und Logis und Kritik wegen zu viel Schmutz auf den Straßen oder betrügerischer Gastwirte. In Paris gingen die Auseinandersetzungen im Jahr 1229 so weit, dass die Universität nach dem gewaltsamen Tod mehrerer Studenten mit Umsiedlung in eine andere Stadt drohte. Papst Gregor IX. erließ daraufhin eine Bulle, die die Eigenständigkeit der Universität von Paris garantierte. Fortan konnten zunehmend selbst die mächtigen Bürgerschaften den Universitäten keine Vorschriften mehr machen.

Der Philosoph Wilhelm von Ockham, bekannt durch das Prinzip von Ockhams Rasiermesser, und der Nominalismus leiteten das Ende stark theoretischer scholastischer Debatten ein und machten den Weg für empirische und experimentelle Wissenschaft frei. Ockham zufolge sollte sich die Philosophie nur mit Dingen beschäftigen, über die echtes Wissen erreicht werden kann (Prinzip der Sparsamkeit, engl. parsimony). Mittelalterliche Vorläufer der experimentellen Forschung kann man bereits in der Wiederentdeckung des Aristoteles und im Werk Roger Bacons sehen. Besonders kritisch äußert sich über die Scholastiker Nikolaus von Kues. Aus prinzipiellen Gründen wendet er sich auch gegen eine Zentralstellung der Erde und nimmt in diesem Punkt das heliozentrische Weltbild des Nikolaus Kopernikus vorweg.
Kurz vor und nach dem Fall Konstantinopels strömten auch verstärkt byzantinische Gelehrte nach Europa (z. B. Bessarion), wie auch bereits vorher byzantinische Kodizes nach Europa gelangt waren (etwa durch Giovanni Aurispa).
Die meisten technischen Errungenschaften des 14. und 15. Jahrhunderts waren nicht europäischen Ursprungs, sondern stammten aus China oder Arabien. Die umwälzende Wirkung folgte nicht aus den Erfindungen selbst, sondern aus ihrer Verwendung. Schießpulver war den Chinesen schon lange bekannt gewesen, doch erst die Europäer erkannten sein militärisches Potenzial und konnten es zur neuzeitlichen Kolonialisierung und Weltbeherrschung nutzen. In diesem Zusammenhang sind auch die Fortschritte der Navigation wesentlich. Kompass, Astrolabium und Sextant erlaubten gemeinsam mit weiterentwickeltem Schiffbau das Bereisen der Weltmeere. Gutenbergs Druckerpresse machte nicht nur die protestantische Reformation möglich, sondern trug auch zur Verbreitung des Wissens bei und damit zu einer Gesellschaft mit mehr Lesekundigen.
Remove ads
Religion
Zusammenfassung
Kontext
Die in Teilen, aber keineswegs insgesamt herrschende apokalyptische Stimmung führte vielfach zum Wunsch der direkten Gotteserfahrung. Das Bibelstudium vermittelte den Menschen das Bild der einfachen Lebensweise Jesu Christi und der Apostel, ein Vorbild, dem die existierende Kirche nicht gerecht wurde, gerade weil das Papsttum seit 1309 in Avignon (Avignonesisches Papsttum) residierte und sich immer mehr von den Menschen entfernte. Hinzu kam das abendländische Schisma von 1378, welches erst durch den Konziliarismus beendet werden konnte (Konzil von Konstanz). Infolge der Glaubenskrise entstanden vermehrt Bettelorden und apostolische Gemeinden, die sich dem einfachen Leben widmen wollten. Viele davon wurden von der Kirche wegen Ketzerei verfolgt, so beispielsweise die Waldenser, Katharer oder die Brüder und Schwestern des freien Geistes. Im Spätmittelalter traten in ganz Europa aus ähnlichen Gründen Judenverfolgungen auf, viele Juden wanderten nach Ostmitteleuropa aus.
Das Große Abendländische Schisma

Seit dem frühen 14. Jahrhundert gelangte das Papsttum zunehmend unter den Einfluss der französischen Krone, bis hin zur Verlagerung seines Sitzes nach Avignon 1309. Als der Papst 1377 beschloss, nach Rom zurückzukehren, wurden in Avignon und Rom unterschiedliche Päpste gewählt, mit dem Resultat des sogenannten Abendländischen Schismas (1378–1417). Die Kirchenspaltung war eine ebenso politische wie religiöse Angelegenheit; während England den römischen Papst unterstützte, stellten sich seine Kriegsgegner Frankreich und Schottland hinter den Papst in Avignon. Italien und insbesondere Rom urteilten in dem Selbstverständnis, der alte Imperiumssitz sei der rechtmäßige Ort für den Sitz der Kirche Jesu Christi. Allerdings waren im Thronkampf von Neapel die älteren Anjou notgedrungen für Avignon, Visconti-Mailand schwankend aufgrund der Beziehungen zu Frankreich.
Auf dem Konzil von Konstanz (1414–1418) wurde das Papsttum wieder in Rom vereinigt. Obgleich die Einheit der Westkirche danach noch hundert Jahre andauerte und obgleich der Heilige Stuhl einen größeren Reichtum anhäufte als jemals zuvor, hatte das Große Schisma doch irreparablen Schaden verursacht. Die inneren Konflikte der Kirche förderten den Antiklerikalismus bei Herrschern und Beherrschten und die Teilung ermöglichte Reformbewegungen mit schließlich einschneidenden Veränderungen.
Reformbewegungen
John Wyclif
Obwohl die Westkirche lange gegen häretische Bewegungen gekämpft hatte, entstanden im Spätmittelalter innerkirchliche Reformbestrebungen. Deren erste entwarf der Oxforder Professor John Wyclif in England. Wyclif sprach sich dafür aus, die Bibel als einzige Autorität in religiösen Fragen zu betrachten und lehnte Transsubstantiation, Zölibat und Ablässe ab. Er übersetzte auch die Bibel ins Englische. Obwohl sie einflussreiche Freunde in der englischen Aristokratie hatte, etwa John of Gaunt, wurde Wyclifs Partei, die Lollarden, letztendlich unterdrückt.
Jan Hus
Die Lehren des böhmischen Priesters Jan Hus basierten mit wenigen Änderungen auf jenen von John Wyclif. Dennoch hatten seine Anhänger, die Hussiten, viel größere politische Auswirkungen als die Lollarden. Hus sammelte in Böhmen zahlreiche Anhänger und als er 1415 wegen Häresie verbrannt wurde, verursachte dies einen Volksaufstand. Die folgenden Hussitenkriege endeten zwar nicht mit der nationalen oder religiösen Unabhängigkeit Böhmens, aber Kirche und deutscher Einfluss wurden geschwächt.
Martin Luther

Die Reformationszeit liegt genaugenommen nicht mehr im Spätmittelalter, doch sie beendete die Einheit der Westkirche, die eines der wichtigsten Merkmale des Mittelalters gewesen war.
Martin Luther, ein deutscher Mönch, löste die Reformation durch seine zahlreiche theologische Fragen betreffende Position aus. Die gesellschaftliche Basis dieser Bewegung setzte sich aus Arbeitern, Studierenden und Jugendlichen zusammen, besonders seine Kritik von Ablasshandel und Bußwesen. Eine wichtige Station dabei war die Verteilung von 95 Thesen an seine dozierenden Kollegen (der Legende nach soll er sie auch an die Schlosskirche zu Wittenberg genagelt haben). Papst Leo X hatte 1514 für den Bau des neuen Petersdoms den Ablasshandel erneuert. Luther wurde vom Reichstag zu Worms (1521) aufgefordert, seine als Häresie verurteilten Ansichten zu widerrufen. Als er sich weigerte, belegte ihn Karl V. mit der Reichsacht. Unter dem Schutz Friedrichs des Weisen von Sachsen konnte er sich zurückziehen und unter anderem eine vollständige Neuübersetzung des Neuen Testaments ins Deutsche anfertigen, die 1534 um eine Neuübersetzung des Alten Testaments ergänzt wurde.
Für viele weltliche Fürsten war die Reformation eine willkommene Gelegenheit, ihren Besitz und Einfluss zu vergrößern, auch das städtische Bürgertum und Bauern konnten von ihr profitieren. Gegen die Reformation wendete sich die katholische Gegenreformation. Europa war nun geteilt in den protestantischen Norden und den katholischen Süden, Grundlage der Religionskriege des 16. und 17. Jahrhunderts.
Remove ads
Kultur
Zusammenfassung
Kontext
Kunst

Die bildende Kunst erfuhr im Spätmittelalter eine enorme Weiterentwicklung.
Im frühen 14. Jahrhundert entstanden die Werke Giottos als Vorläufer der Renaissance. In der Malerei spricht man von der nördlichen Renaissance mit Zentrum in den Niederen Landen und der italienischen Renaissance mit Florenz als Angelpunkt. Während die nördliche Kunst mehr auf Muster und Oberflächen gerichtet war, etwa die Gemälde des Jan van Eyck, erforschten italienische Maler auch Bereiche wie Anatomie und Geometrie. Die Entdeckung der Fluchtpunkt-Perspektive (Zentralprojektion), die Brunelleschi zugeschrieben wird, war ein wichtiger Schritt zu optisch realistischen Darstellungen. Die italienische Renaissance erreichte ihren Höhepunkt mit der Kunst Leonardo da Vincis, Michelangelos und Raffaels.
Architektur
Während die gotische Kathedrale in den nordeuropäischen Ländern sehr in Mode blieb, konnte sich dieser Baustil in Italien nie recht durchsetzen. Hier ließen sich die Architekten der Renaissance von klassischen Gebäuden inspirieren, das Meisterwerk dieser Zeit war Filippo Brunelleschis Dom Santa Maria del Fiore in Florenz.
Literatur
Die wichtigste Entwicklung in der spätmittelalterlichen Literatur war der zunehmende Gebrauch der Volkssprachen gegenüber dem Latein. Beliebt waren Romane, die oft die Legende vom Heiligen Gral zum Thema hatten.
Der Autor, der vor allen anderen die neue Zeit ankündigte, war Dante Alighieri. Seine Göttliche Komödie, in italienischer Sprache geschrieben, beschreibt zwar eine mittelalterlich-religiöse Weltsicht, in der er auch verankert war (siehe Monarchia), bedient sich aber dazu eines Stils, der auf antiken Vorbildern basiert. Andere Förderer des Italienischen waren Francesco Petrarca, dessen Canzoniere als erste moderne Gedichte gelten, und Giovanni Boccaccio mit seinem Decamerone. In England trug Geoffrey Chaucer mit seinen Canterbury Tales dazu bei, Englisch als Literatursprache zu etablieren. Wie Boccaccio beschäftigte sich Chaucer mehr mit dem alltäglichen Leben als mit religiösen oder mythologischen Themen. In Deutschland wurde schließlich Martin Luthers Übersetzung der Bibel zur Basis für die deutsche Schriftsprache.
Remove ads
Quellenlage
Zusammenfassung
Kontext
Die Quellenlage für das Spätmittelalter ist die beste des gesamten Mittelalters. Vor allem die schriftliche Überlieferungslage erhöht und verbreitert sich seit dem späten 13. Jahrhundert beständig.[509] Noch im 14. Jahrhundert verbessert sie sich und wird durch neue Quellengattungen erweitert,[510] bevor sie dann im 15. Jahrhundert einen neuen Höhepunkt erreicht, wobei der Buchdruck (ab Ende des 15. Jahrhunderts) als positiver Faktor hinzu kommt.[511]
Diese Entwicklung ist von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst und hängt nicht zuletzt mit der Zunahme der Schriftlichkeit und der Aktenführung zusammen. Dies betrifft alle politischen Ebenen (Reich, Landesherren, Städte und Kirche samt Erlasse, Urbare, Amtsbücher, Rechtsurteile, Protokolle usw.),[512] wobei zusätzlich wesentlich mehr Urkunden ausgestellt werden. Diese verbreiterte Überlieferungslage spiegelt sich unter anderem in der Auswertung der modernen Regesten gerade für das 15. Jahrhundert wider.[513] Aber auch im kaufmännischen Sektor wächst Bedeutung und Umfang der „pragmatischen Schriftlichkeit“.[514] Des Weiteren nehmen Lese- und Schreibfähigkeiten im Verlauf des Spätmittelalters immer weiter zu (Bildung ist längst nicht mehr auf die Geistlichkeit beschränkt), die Volkssprachen gewinnen an Bedeutung und günstigeres Papier ist besser verfügbar.
Die Renaissance und eine vergrößerte Gelehrtenkultur tragen ebenfalls dazu bei, so dass auch im europäischen Kontext die Quellendichte sehr hoch ist. In England beispielsweise ist die königliche Aktenführung (wie Steuerakten und Gerichtsurteile) ohnehin bereits im Hochmittelalter stark ausgeprägt gewesen und stieg im Spätmittelalter an, in Italien beginnt frühzeitig die Rechnungsführung. Zu den dokumentarischen Quellen aller Art kommen zahlreiche weitere Quellengattungen hinzu. Dazu gehören eine überaus reichhaltige Vielfalt gelehrter Abhandlungen (theologische und philosophische Texte, staatstheoretische Traktate, technische Abhandlungen u.v.m.), zahlreiche erzählende Geschichtsquellen, Gedichte, Epen, Briefe und andere private Texte (wie Tagebücher und Testamente) etc., sowohl in Latein als auch in den diversen Volkssprachen. So ist die spätmittelalterliche Literatur insgesamt deutlich umfangreicher und facettenreicher als zuvor. Eine Darlegung der diversen Autoren würde den Rahmen sprengen. Im Artikeltext werden einige der wichtigsten Namen genannt, es sei aber nachdrücklich auf die hier genannten Forschungs- und Quellenüberblicke[515] sowie die Literaturgeschichten[516] hingewiesen (siehe im Literaturverzeichnis des Artikels). Nützlich ist unter anderem das digitale Repertorium „Geschichtsquellen des deutschen Mittelalters“. Unverzichtbar zur ersten Orientierung bleibt das Lexikon des Mittelalters.
Zentrale Quelleneditionen stellen für das römisch-deutsche Reich unter anderem (neben den diversen MGH-Ausgaben) die Reichstagsakten und Die Chroniken der deutschen Städte dar. Zahlreiches ungedrucktes Material ist in den Regesta Imperii verzeichnet. Auswahl an übersetzten Quellentexten bieten:
- Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters (speziell die Bände 33, 36–39, 44, 46 und 50);
- Die Geschichtschreiber der deutschen Vorzeit (speziell ab Band 79; einige Übersetzungen wurden bis heute nicht ersetzt).
Des Weiteren sind zahlreiche nicht-schriftliche Quellen von Bedeutung. Dazu gehören neben Realien aller Art erhaltene Bauwerken, die verschiedensten Kunstwerke, die im Rahmen der kulturellen Belebung der Renaissance erheblich zunehmen (wie beispielsweise Skulpturen und die Malerei), und Befunde im Rahmen der Mittelalterarchäologie (einschließlich moderner Analysetechniken, wie beispielsweise Archäogenetik).
Remove ads
Literatur
Zusammenfassung
Kontext
Im Folgenden wird nur eine sehr begrenzte Auswahl aus der überaus umfangreichen Fachliteratur genannt.[517] Für weiterführende Hinweise sei auf die jeweiligen Bibliographien verwiesen.
Forschungsüberblickswerke
(jeweils mit umfassender Bibliographie)
- Ulf Dirlmeier, Gerhard Fouquet, Bernd Fuhrmann: Europa im Spätmittelalter 1215–1378 (= Oldenbourg Grundriss der Geschichte. Band 8). 2. Auflage. Oldenbourg, München 2009 (Rezension der 1. Auflage (2003)).
- Erich Meuthen: Das 15. Jahrhundert (= Oldenbourg Grundriss der Geschichte. Band 9). 5. Auflage. Oldenbourg, München 2012.
Europäisch ausgerichtete Überblickswerke
(Literatur zu den einzelnen Staaten und Regionen wird in den Anmerkungen genannt.)
- David Abulafia (Hrsg.): C.1198–c.1300 (= The New Cambridge Medieval History. Band 5). Cambridge University Press, Cambridge 1999, ISBN 978-1-107-46066-9.
- Michael Jones (Hrsg.): C.1300–c.1415 (= The New Cambridge Medieval History. Band 6). Cambridge University Press, Cambridge 2000, ISBN 978-0-521-36290-0.
- Christopher Allmand (Hrsg.): C.1415–c.1500 (= The New Cambridge Medieval History. Band 7). Cambridge University Press, Cambridge 1998, ISBN 978-0-521-38296-0.
- Alfred Kohler: Expansion und Hegemonie. Internationale Beziehungen 1450-1559 (= Handbuch der Geschichte der internationalen Beziehungen. Band 1). Ferdinand Schöningh, Paderborn 2008.
- Isabella Lazzarini (Hrsg.): The Later Middle Ages (Short Oxford History of Europe). Oxford University Press, Oxford 2021.
- Michael North: Europa expandiert. 1250–1500 (= Handbuch der Geschichte Europas 4). Ulmer, Stuttgart 2007.
- Bernd Schneidmüller: Grenzerfahrung und monarchische Ordnung: Europa 1200–1500. Beck, München 2011, ISBN 978-3-406-61357-9.
- Hubertus Seibert: Geschichte Europas im Mittelalter. Aufbruch in die Vielfalt. Brill/Schöningh, Paderborn 2025.
- John Watts: The Making of Polities: Europe, 1300–1500. Cambridge University Press, Cambridge 2009, ISBN 978-0-521-79232-5.
Das römisch-deutsche Reich im Spätmittelalter
- Überblickswerke
- Handbuch der deutschen Geschichte. 10. Auflage:
- Michael Menzel: Die Zeit der Entwürfe (1273–1347). Klett-Cotta, Stuttgart 2012, ISBN 978-3-608-60007-0.
- Christian Hesse: Synthese und Aufbruch (1346–1410). Klett-Cotta, Stuttgart 2017, ISBN 978-3-608-60072-8.
- Hartmut Boockmann, Heinrich Dormeier: Konzilien, Kirchen- und Reichsreform 1410–1495. Klett-Cotta, Stuttgart 2005, ISBN 3-608-60008-6.
- Bernd Fuhrmann: Deutschland im Mittelalter. Wirtschaft – Gesellschaft – Umwelt. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2017.
- Peter Moraw: Von offener Verfassung zu gestalteter Verdichtung. Das Reich im späten Mittelalter 1250 bis 1490 (= Propyläen-Geschichte Deutschlands. Band 3). Propyläen Verlag, Berlin 1985, ISBN 3-549-05813-6.
- Malte Prietzel: Das Heilige Römische Reich im Spätmittelalter (= Geschichte kompakt). Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2004, ISBN 3-534-15131-3
- Ernst Schubert: Einführung in die deutsche Geschichte im Spätmittelalter. 2., bibliographisch aktualisierte Auflage. Primus-Verlag, Darmstadt 1998, ISBN 3-89678-313-0.
- Heinz Thomas: Deutsche Geschichte des Spätmittelalters. 1250–1500. Kohlhammer, Stuttgart u. a. 1983, ISBN 3-17-007908-5.
- König, Reich und Dynastien
- Jörg K. Hoensch: Die Luxemburger. Eine spätmittelalterliche Dynastie von gesamteuropäischer Bedeutung 1308–1437. Kohlhammer, Stuttgart u. a. 2000.
- Ludwig Holzfurtner: Die Wittelsbacher. Staat und Dynastie in acht Jahrhunderten. Kohlhammer, Stuttgart 2005.
- Karl-Friedrich Krieger: Die Habsburger im Mittelalter. Von Rudolf I. bis Friedrich III. 2., aktualisierte Auflage. Kohlhammer, Stuttgart 2004, ISBN 3-17-018228-5.
- Karl-Friedrich Krieger: König, Reich und Reichsreform im Spätmittelalter. 2., durchgesehene Auflage. Oldenbourg, München 2005.
- Bernd Schneidmüller, Stefan Weinfurter (Hrsg.): Die deutschen Herrscher des Mittelalters. Historische Porträts von Heinrich I. bis Maximilian I. (919–1519). Beck, München 2003, ISBN 3-406-50958-4.
- Bernd Schneidmüller, Stefan Weinfurter (Hrsg.): Heilig – Römisch – Deutsch. Das Reich im mittelalterlichen Europa. Internationale Tagung zur 29. Ausstellung des Europarates und Landesausstellung Sachsen-Anhalt. Sandstein-Verlag, Dresden 2006.
- Ernst Schubert: König und Reich. Studien zur spätmittelalterlichen deutschen Verfassungsgeschichte. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1979.
- Ernst Schubert: Fürstliche Herrschaft und Territorium im späten Mittelalter. 2. Auflage. Oldenbourg, München 2006.
- Hans K. Schulze: Grundstrukturen der Verfassung im Mittelalter. Band 3 (Kaiser und Reich). Kohlhammer, Stuttgart u. a. 1998.
- Hans K. Schulze: Grundstrukturen der Verfassung im Mittelalter. Band 4 (Das Königtum). Kohlhammer, Stuttgart u. a. 2011.
- Kultur und Alltag
- Wolfgang Achnitz (Hrsg.): Deutsches Literatur-Lexikon. Das Mittelalter. 8 Bände. De Gruyter, Berlin 2011–2016.
- Hartmut Boockmann: Die Stadt im späten Mittelalter. Beck, München 1986.
- Hans-Friedrich Rosenfeld, Hellmut Rosenfeld: Deutsche Kultur im Spätmittelalter 1250–1500 (= Handbuch der Kulturgeschichte. Band I 5). Wiesbaden 1978, ISBN 3-7997-0713-1.
- Ernst Schubert: Alltag im Mittelalter. Natürliches Lebensumfeld und menschliches Miteinander. 3. erweiterte Auflage. WBG, Darmstadt 2019.
- Rolf Sprandel: Verfassung und Gesellschaft im Mittelalter. 5. überarbeitete Auflage. UTB, Paderborn u. a. 1994.
- Burghart Wachinger: Deutschsprachige Literatur des Mittelalters. De Gruyter, Berlin/New York 2001.
- Martin Warnke: Geschichte der deutschen Kunst. Bd. 2 (Spätmittelalter und Frühe Neuzeit 1400–1750). Beck, München 1999.
- Verfasserlexikon. 2., völlig neu bearbeitete Auflage.
Spezialliteratur zu Europa im Spätmittelalter
- Wirtschaft, Gesellschaft und Herrschaft
- Klaus Bergdolt: Der Schwarze Tod in Europa. Die große Pest und das Ende des Mittelalters. 4. Auflage. Beck, München 2017.
- Philippe Dollinger: Die Hanse. 6., vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage. Kröner, Stuttgart 2012.
- Thomas Ertl: Bauern und Bankern. Wirtschaft im Mittelalter. WBG, Darmstadt 2021.
- Reinhard Schneider (Hrsg.): Das spätmittelalterliche Königtum im europäischen Vergleich. Sigmaringen 1987 (online).
- Rainer Christoph Schwinges, Christian Hesse, Peter Moraw (Hrsg.): Europa im späten Mittelalter. Politik - Gesellschaft - Kultur. Oldenbourg, München 2006.
- Sebastian Steinbach: Einführung in die Wirtschaftsgeschichte. Band 3 (Mittelalter). Kohlhammer, Stuttgart 2021.
- Kirche und religiöse Fragen
- Arnold Angenendt: Grundformen der Frömmigkeit im Mittelalter. 2., durchgesehene Auflage. Oldenbourg, München 2004.
- Arnold Angenendt: Geschichte der Religiosität im Mittelalter. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1997.
- Klaus Herbers: Geschichte des Papsttums im Mittelalter. WBG, Darmstadt 2012.
- Thomas Kaufmann, Raymund Kottje (Hrsg.): Ökumenische Kirchengeschichte. Band 2. WBG, Darmstadt 2008.
- Heribert Müller: Die kirchliche Krise des Spätmittelalters. Schisma, Konziliarismus und Konzilien. Oldenbourg, München 2012.
- Kulturgeschichte
- Johannes Grabmayer: Europa im späten Mittelalter 1250–1500. Eine Kultur- und Mentalitätsgeschichte. WBG, Darmstadt 2004.
- Anton Grabner-Haider, Johann Maier, Karl Prenner: Kulturgeschichte des späten Mittelalters. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2012.
- Jan Rohls (Hrsg.): Spätmittelalter und Renaissance (Kunst und Religion zwischen Mittelalter und Barock 1). De Gruyter, Berlin/Boston 2021.
- Willi Erzgräber (Hrsg.): Europäisches Spätmittelalter. Wiesbaden 1978 (= Klaus von See (Hrsg.): Neues Handbuch der Literaturwissenschaft. Band 8).
- Ralph Hexter, David Townsend (Hrsg.): The Oxford Handbook of Medieval Latin Literature. Oxford University Press, Oxford 2012.
- Bernd Roeck: Der Morgen der Welt. Geschichte der Renaissance. Beck, München 2017, ISBN 978-3-406-69876-7.
- Philosophie
- Thomas Leinkauf: Grundriss Philosophie des Humanismus und der Renaissance (1350–1600). 2 Bände. Meiner, Hamburg 2017.
- Henning Ottmann: Geschichte des politischen Denkens. Band II/2 (Das Mittelalter). Metzler, Stuttgart/Weimar 2004.
Klassiker
(veralteter Forschungsstand)
- Hermann Heimpel: Deutschland im späteren Mittelalter. Konstanz 1957.
- Johan Huizinga: Herbst des Mittelalters. Fink, Paderborn 2018, ISBN 978-3-7705-6242-8 (niederländisches Original 1919 veröffentlicht).
- Bernhard Schmeidler: Das spätere Mittelalter von der Mitte des 13. Jahrhunderts bis zur Reformation. Wien 1937 (ND Darmstadt 1980).
Remove ads
Weblinks
Commons: Spätmittelalter – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wiktionary: Spätmittelalter – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
- Literatur von und über Spätmittelalter im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Suchergebnisse im Regesta Imperii OPAC
Anmerkungen
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads
